|
Goldschmied Maler und Bildhauer |
 |
||||||||||||
| INHALT STARTSEITE DIE AUTORIN BESTELLEN BUCHHANDLUNGEN Kritiken in der Presse: Pressestimmen-1 Pressestimmen-2 Aus dem Buch: DER KÜNSTLER EGINO G. WEINERT ALS LEHRLING Als Bruder im Kloster Münsterschwarzach Rausschmiss aus dem Kloster Begegnung mit Picasso Begegnungen mit den Päpsten AGBs Kontakt IMPRESSUM |
EVAMARIA KEPPER: EGINO WEINERT LEBEN UND WERK 
WERKSCHULE KÖLN 28.August.1947 - 19.August.1949 Bei der Vorlage meiner Paxtafel als Bewerbungsunterlage an der Werkschule in Köln meinte Professor Vordemberge, der Leiter der Schule: —Wenn Sie das selber gemacht, selber entworfen haben, können Sie uns hier ausbilden.ž Ich fand in Bonn Aufnahme bei den Barmherzigen Brüdern im Bonner Talweg und fuhr um sechs Uhr nach dem Besuch der Messe nach Köln, wo so früh die Türen der Werkschule noch verschlossen waren. Hier mußte ich Frau Professor Treskow, deren gute Goldschmiedearbeiten ich schon auf einer Ausstellung kennengelernt; sie hatte die Schule der Goldschmiede hier übernommen. Ihr musste ich erst einmal behilflich sein, den leeren Raum im ausgebombten Köln als Werkstatt einzurichten. Werkzeuge und Maschinen mussten aus ihrer Werkstatt in Essen rübergeschleppt werden. Gas gab es nicht. Ich machte eine Anlage wie im Kloster, mit der man aus Benzin Gas erzeugen konnte. Alle Vorlesungen und Seminare, die an der Kunstwerkstatt zeitlich möglich waren, belegte ich. Außerdem studierte ich Metallbildhauerei bei Professor Jeckel, Graphik bei Professor Hussmann und ein halbes Semester Kunstgießerei. Auschlaggebend für mich war die Ausbildung bei Professor Hussmann. Er fand, meine Karikaturen seien wunderbar, ich sollte dabei bleiben und keine christliche Kunst machen. Meine Christusgestalten seien zu fromm, halbe Nazarener. Der Nazarener Stil bildete sich durch eine Schule in Rom, die Schönheitsideale der italienischen Renaissance als Vorbild ansah. Weltweit wurden Kirchen und Klöster in dem Stil ausgemalt (eine denkmalgeschützte Kirche der Franziskaner steht bei Remagen). Professor Hussmann malte Karikaturen mit Wasserköpfen, was mir zu unwürdig war. Immer meckerte er an mir herum, aber trotzdem waren wir bis zu seinem Tode befreundet.  SUCHE NACH VORBILDERN IN DER KUNST Meine Vorbilder? Jeder hat eine bestimmte Art zu malen. Jeder Lehrer der Kölner Werkschule arbeitete anders. Wir alle suchten nach dem Krieg nach neuen Vorbildern. Hier in Köln stieß ich auf eine Gruppe von Nolde-Anhängern, aber auch auf Auguste Rodin und vor allem den Franzosen Georg Rouault, ein Maler und Grafiker, der 1871-1958 lebte. Seine schwarzen Konturen und leuchtenden Farbflächen, die an alte Glasmalereien erinnern, standen hoch im Kurs. Sehr stark hat mich Mataré beeindruckt. Ewald Mataré (1887-1965) war Professor an der Akademie in Düsseldorf; seine frühen Holzschnitte gehören dem Expressionismus an. Als Bildhauer besonders von Tierfiguren aus kostbaren Hölzern gelangte er zu vereinfachten Formen. Zum Spätwerk gehören drei bronzene Türflügel am Kölner Dom. Als Junge schon hat mich Anton Wendelin aus Aachen fasziniert. Ich sammelte seine Werke und verglich sie mit Nachbildungen. Mit Karl Bauer, meinem Unteroffizier bei der Marine, hatte ich viel zusammen gemalt. Corbusier habe ich sehr verehrt. Er hat in Gemälden Picasso nachgeahmt, wo er nur konnte. Seine Teppiche sind hinreißend. In Paris gab es einmal eine gemeinsame Ausstellung von Picasso und ihm. Man mußte sich einfach fragen, wie können zwei unterschiedliche Menschen so Gleiches hervorbringen. Picasso hat auch Teppiche gemacht, aber keine guten, er hatte scheinbar auch nicht den Ehrgeiz. 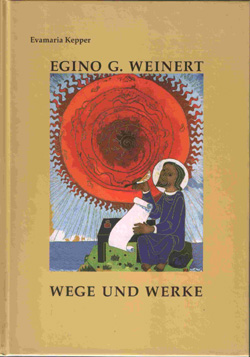 WER KANN EINEN CHRISTUS MACHEN? In der Bildhauerklasse bei Professor Jaeckel habe ich einen großen Christus geformt, aus Ton, getrieben mit einer Hand. Als ich den Christus fertig hatte, war —große Besprechungž. Die Lehrer der Schule standen vor meinem Christus. Feierlich überreichte man mir den Semesterpreis als beste Arbeit des Semesters. Da nahm Professor Jaeckel meinen Christus und schmiß ihn wieder in den Tontrog zurück; ich wäre am liebsten hinterher gesprungen. Er sagte, das sei zu reif, als dass ein Schüler das hätte machen können. —Sie haben zuviel Kunst studiert, das kann unmöglich auf ihrem Mist gewachsen sein. Machen Sie einen neuen, wenn der nächste genauso gut ist, glaube ich Ihnen.ž B.: —Das verstehe ich nicht.ž E.G.W.: —Ja, doch, das war eine ganz tolle Arbeit.ž B.: —Was war Jaeckel für ein Mann?ž E.G.W.: —Er war eifersüchtig, ein Könner, ein Wissender, ein guter Lehrer, ein ganz großartiger Lehrer.ž B: —War er Christ?ž E.G.W.: —Ein überzeugter Christ. Kein fleißiger Mann. Wenn er in einem Jahr eine Figur fertigstellte, war das viel. Er hat Preise genommen, die keiner bezahlen konnte.ž B.: —Hast du einen neuen Christus gemacht?ž E.G.W.: —Ja, ich habe mehrere gemacht, ich habe weiter daran gearbeitet, aber ich muß gestehen, ich kann heute noch keinen Christus machen.ž B.: —Wer kann das?ž Egino fährt fort.: —Ja, das stimmt. Das ist so etwas Schweres. Dieser Christus, den ich dir hier zeige, ist kurz danach entstanden, hier kommt etwas, was wir nicht ausdrücken können. Wenn ich den Kopf sehe, den würde ich heute anders machen. Dieser kräftige Körper, mit dem ich ausdrücken wollte: ich will euch erlösen! Gleichzeitig hat der Künstler Gies einen Christus gemacht, den siehst du in der Engelskirche in Essen am Bahnhof. Und ein Christus ist entstanden von Frau Treskow in Schwarzrheindorf. Vorher habe ich in Münsterschwarzach bei Frater Maurus Kraus mitgearbeitet. Es ist ein Ausdruck in der Figur, den wir nicht erklären können.ž BRUDER EGINO ALS KUNSTKENNER Zu dieser Zeit war eine Romanikausstellung in der ehemaligen Universität von Köln unten am Rhein. Man hatte Egino G. Weinert geholt, um zu beurteilen, ob die Sachen gut seien oder reparaturbedürftig. Da lagen zwei Christuskörper vor ihm. Professor Lützeler hatte dazu geschrieben, sie seien aus der Zeit um 865 und 985. Dieser bat ihn, er möge die Skulpturen aus der Vitrine herausholen und sagte: —Die eine ist von achthundert soundsoviel, glaube ich, romanisch. Aber die andere ist 1860 oder 1880 nachgegossen worden nach dem Vorbild des ersten Christuskörpers.ž —Wie können Sie das behaupten! Kunsthistorisch ist das nachgewiesen und in soundsoviel Büchern beschrieben.ž Egino konnte die Herren überzeugen. —Bei der nachgegossenen Figur sind die Haare viel zu sauber nachziseliert. Ein Künstler ist souverän, macht nicht so langweilige Haare. Der eine Christus trägt eine Krone, der andere keine. Da stand zu lesen, das eben sei der Beweis vom Christkönig hin zum leidenden Heiland, von der Königsidee weg zur Gefühlswelt.ž Tatsächlich aber hatte einer die Krone weggefeilt und relativ schöne Haare hingezaubert. Egino machte darauf aufmerksam, dass der eine Christus kleiner sei, weil bei jedem Nachguss ein Schwund entsteht. Auf der Rückseite war zudem bei beiden ein gleicher Fehler mitgegossen worden. Seitdem lud Professor Lützeler ihn, den Volksschüler, immer wieder zu seinen Universitätsvorlesungen in Bonn ein. Der Dreikönigsschrein aus dem Kölner Dom war während des Zweiten Weltkrieges zerlegt und versteckt worden. 1948 hatten Professor Treskow und Egino, ihr Student, den Schrein wieder zusammengesetzt. Der Dom stand vor der Wiedereröffnung. Alle Schreine der Kölner Kirchen sollten feierlich durch das zerstörte Köln getragen werden. Versammelt waren Kardinal Frings, Oberbaurat Schlomps, Professor Lützeler, sowie Domvikar Hoster, der sagte: —Bruder Egino, ich bringe Ihnen das größte Kunstwerk, das wir in Köln besitzen, die Severins-Plakette.ž Er nahm die Plakette in die Hand und stellte fest: —Die ist 1924 in Köln gemacht worden.ž Der Kopist hieß Zeegruber. Kardinal Frings meinte daraufhin: —Studieren Sie doch erst mal Kunst, bevor Sie so etwas behaupten.ž Plötzlich stand der Küster in der Tür von St. Severin und hielt in der Hand eine Plakette hoch: —Hier ist die echte Severins-Plakette. Sie soll aus Sicherheitsgründen morgen erst, kurz vor der Prozession, gegen die Imitation im Schrein ausgetauscht werden.ž Domvikar Hoster fragte mich: —Woher wissen Sie, dass das ein unechtes Stück ist?ž —Ein Kunstwerk hat Fehler, ist nicht so sauber gemacht, ist souverän. Das ist natürlich auch aus echtem Gold. Das Imitat hier ist Jugendstil.ž Oben am Schrein waren Scheiben angebracht. Vieles ist verloren gegangen. Die Severinsplakette ist übriggeblieben, ein altes Stück eines byzantinischen Schreines. Von diesen Arbeiten gibt es noch etwas im Dom zu Trier. Da stand er, ein kleiner Mönch mit einer Hand, und wurde gefragt, was an diesem Schrein nun echt sei und was nicht. Er ging entlang: —Echt, echt, unecht, echtž und erklärte: —Das eine ist galvanisch, das andere feuervergoldet. Feuervergoldet hat man schon vor tausend Jahren, und das sieht man heute noch. Das Galvanvergoldete aber sah mal gut aus. Die neuen Dinge sind ganz ordentlich gemacht, kindlich nachgewerkelt, als im 19. Jahrhundert soviel kopiert wurde. Die alten Stücke dagegen sind eigenständig und ausdrucksstärker.ž Das war eine große Stunde für ihn. Danach legte ein Kunsthistoriker ihnen die Zeitschrift —Das Münsterž vor mit einem Artikel über die größte Fälschungsgeschichte des 20. Jahrhundert von Jan Vermeer, einem der größten Maler des 17. Jahrhunderts. Der Würzburger Max Rössler, Journalist, Rechtsanwalt und Priester, hatte ihm vor einiger Zeit ein Buch geschenkt über Vermeer. Schon damals meinte Egino: —Das hat nie ein Künstler gemaltž, woraufhin Rössler erwiderte, —Egino, Du hast doch eine —gottverdammte Berliner Schnauzež, studiere erst mal und dann kannst du reden.ž Später gab Egino ihm das Buch zurück mit den Worten: —Siehst du, auf die Fälschung habe ich dich damals schon aufmerksam gemacht.ž 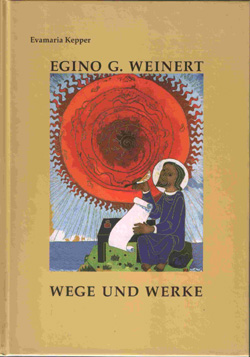 DAS MÄDCHEN MIT ROTEM PO An der christlichen Werkschule in Köln gab Professor Vordemberge Malunterricht. Unser Aktmodell war eine Frau aus Düsseldorf, die sich etwas verdienen wollte. Jeder von uns hatte über seiner Staffelei einen Regenschirm, weil das Wasser an den Wänden herunterlief, denn so kurz nach dem Krieg war vieles noch nicht repariert. Die Frau zog sich aus. Wir verfügten über einen Kanonenofen, hatten aber nichts zum Heizen. Da nahmen wir vom Hörsaal in Teilen den Parkettboden auf. Die Parkettstücke hatten Teer an der Unterseite und waren zu groß, als dass man sie ganz in den Ofen hätte schieben können. Der Raum wurde erwärmt, und als sich das Modell auf das Podium stellte, holten wir das glimmende Holz wieder aus dem Ofen und legten es irgendwo in die Ecke, weil es sonst zu sehr gequalmt hätte. Das Modell schmiss sich nun auch aufs Podium wie immer und landete auf den heißen Parkettstücken. Sie sprang auf und tanzte herum. Der Teer lief ihr am Po herunter. Daraufhin machten sich fast alle grinsend auf und davon. Der Professor rief: —Jetzt helfen Sie doch mal, Bruder Egino, das ist eine leidende Frau, das sehen Sie doch.ž Ja, was sollte ich machen, natürlich habe ich ihr das heiße Parkettstück abgezogen und ein ganzes Hautstück gleich mit dazu. Um alles wieder sauber zu bekommen, ging ich mit ein paar Fläschchen in jede Klasse und alle spendeten uns etwas Spiritus, Petroleum oder Terpentin, damit wir die Dame säubern konnten. Das war für mich furchtbar. Ich hatte ja noch nie eine Frau angefaßt. Als ich fertig war, läutete der Professor: —So, Bruder Egino ist fertig, ihr könnt alle kommen.ž Unser Malthema hieß —Mädchen mit rotem Pož. Die vier Bilder, die ich damals malte, waren sehr gut gelungen. Nur eines hab ich noch. Im Anatomieunterricht mußte ich Frauen zeichnen; die Professoren aber meinten, meine Frauen sähen so komisch aus, wie Holzklötze. Du mußt die Frauen anfassen, bei deinen Bildern fehlt das Gefühl, sie sind spekulativ, berechnend, hölzern, sagten sie. Und ich gebe ihnen recht. Heiermann, ein Kommilitone, hatte neun Kinder, er hat viel mit mir darüber gesprochen und modelliert. Dieses Spiel - Mann und Frau - stellte er gerne als Maler dar, trank gerne und malte mystische Figuren. Wenn man die Bilder von Fra Angelico sieht, fällt einem auf, dass sie so keusch und so geschlechtslos sind. Man sieht Ornamenten an, ob einer das Geschlechtliche liebt oder die Dinge aus zölibatärer Sicht betrachtet. 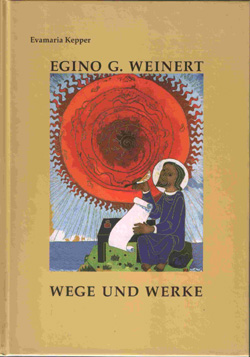 BETTELN IN DER STUDIENZEIT In Köln herrschten während meiner Studienzeit kurz nach dem Krieg große Armut und Hunger. Oft ging ich von Tür zu Tür und erbat mir ein Stück Brot oder eine Kartoffel, die ich unter dem Arm wärmte. Ein Kommilitone begleitete mich ab und zu. Es wurden auch Speisen von sozialen Institutionen ausgeteilt. Einmal am Tag gab es in der Kunstschule einen Schlag —Hooverspeisež, die der Pförtner der Schule austeilte. Um zwei Uhr ging ich meist noch an den Haustüren betteln, weil ich mit dem Schlag Graupensuppe nicht auskam. So bettelte ich auch einmal bei den Vincentinerinnen in Maria-Hilf. Sie ließen mich von zwei bis vier Uhr warten, bevor sie mich mit einer Hand endlos Leuchter putzen ließen. Sie warteten, bis der letzte Leuchter fertig war. Endlich kam das Essen. Aber ich dachte: —Da gehst du nicht mehr hin. Zwei Stunden Studium sind mir viel wichtiger als das Essen hier.ž Manchmal fuhr ich zu Besuch nach Düsseldorf zu meinem Freund Ewald Jorzig. Abends ab zehn Uhr kam Gustaf Gründgens vom Schauspielhaus rüber und dann wurde leidenschaftlich rezitiert und politisiert. Wein wurde getrunken, Wein, Wein und nochmals Wein! Mein Habit, das ich aufgehängt hatte, schnappte er sich, warf es gestikulierend über: —Das ist die Kleidung, mit der man schauspielern kannž. Es ging oft durch bis morgens um zwei. Um drei Uhr fuhr der erste Zug zurück nach Bonn.  ALTE SILBERSCHMELZTECHNIKEN WIEDERENTDECKT In alten Büchern habe ich noch im Kloster das alte, mönchische Wissen wiederentdeckt, mit Kupfer den Schmelzpunkt von Silber reduzieren zu können. Der Mönch Theophil von St. Panthaleon in Köln hat im 11. Jahrhundert die —Schedula aureaž geschrieben, die von Goethe übersetzt wurde. Darin wurde das Wissen der damaligen Zeit festgehalten. Silber schmilzt normalerweise bei 950 Grad, wenn man aber Kupfer zum Silber zufügt, fällt der Schmelzpunkt bis auf 750 Grad. Aber anschließend steigt der Schmelzpunkt wieder an bis zur Sättigung. Früher hat man mit Ein-Drittel-Lot gelötet. Das bedeutet eine Zusammensetzung von ein Drittel Kupfer, zwei Drittel Silberanteilen. Damals brauchte man Holzkohlenfeuer zum Schmelzen, das von unten kommt und von Natur aus eine reduzierende Wirkung hat. (Bei der heutigen Verwendung von Gasen lässt sich dieser Prozeß nicht durchführen, weil das Kupfer oxydiert, es sei denn, man nimmt Wasserstoff zum Schmelzen.) Zur Granulation, der Verschmelzung von zwei Platten mittels Kupfer habe ich ausgeknobelt, die Veränderung des Schmelzpunktes nicht mit Kupfersalz durchzuführen, sondern die Platten und Drähte galvanisch zu verkupfern. Wenn man mit Kupfersalzen arbeitet, wird die Oberfläche schmutzig von Kupfer, und da die Unterplatte mitschmilzt, entsteht auch eine —krusseligež Unterplatte. Professor Treskow hatte den Auftrag, die Staurothek von Limburg zu restaurieren. Die Staurothek ist ein griechischer Kreuzbehälter, ein Reliquiar für ein Teil des Heiligen Kreuzes, der im 10. Jahrhundert entstand und heute zum Domschatz von Limburg zählt. Durch die Vermittlung von Professor Treskow konnte die Restauration dort nach dieser Methode durchgeführt werden. Als ich Student in der Kölner Werkschule war, ließ mich Professor Irsch, Prälat in Trier und Leiter des Kunstmuseums, zu sich kommen. Er erzählte ich sollte ihm die beim Andreasschrein angewandte Technik erläutern. Er mußte daraufhin seine Ausführungen in seinen Büchern korrigieren, denn, so erklärte ich ihm, auch am Kölner Severinsschrein sei eine Platte beschädigt, so dass man sehen könne, dass das Emaillewerk wirklich aus zwei Platten bestehe. Er war begeistert von meiner Theorie.ž Soweit zunächst die Erzählung von Egino. LEBENSGEWOHNHEITEN IM KLOSTER Bruder Cornelius Hell OSB, Münsterschwarzach, ein langjähriger Wegbegleiter Eginos im Kloster, bemerkt heute dazu: —Die Kunstauffassungen von Bruder Maurus Kraus und Pater Wunibald Kellner, dem Leiter der Kunstwerkstätten, deckten sich nicht. Auch Bruder Egino, der die Kunstwerkstätten inspirierte, wurde nur geduldet. Er wollte weg vom Beuroner Stil, wollte etwas Neues schaffen und stieß damit auf Widerstand, und auch weil er sehr sprunghaft war. Ein Offizial wachte über die Kunstwerkstätten. Nichts durfte gefertigt werden, ohne von ihm abgesegnet zu sein. Es herrschte ein autoritäres Prinzip: entweder tun, was angeordnet wird, oder man konnte gehen. Wir waren Kinder unserer Zeit. Das damalige Autoritätsdenken herrschte auch im Kloster. Nur Pater Theophil trat offener für die moderne Kunstrichtung ein. Bruder Egino hatte schon im Internat seinen eigenen Lebensstil, ging seinen Weg. Auch innerhalb der Lehrlinge stieß er auf Widerstand. Man war ihm nicht gewachsen. Er redete fast ununterbrochen, war sehr aufgeschlossen, interessiert, entgegenkommend, drückte sich vor keinem Dienst und integrierte sich in die Gemeinschaft. Früher aber gab es keine Selbständigkeit. Wir waren gewohnt, den vorgezeichneten Weg zu gehen. Heute ist jeder im Kloster selbstverantwortlich.ž Die Patres waren geistliche Begleiter, als Instruktoren oder Novizenmeister verantwortlich für die seelische Betreuung der Laienbrüder. Besprechungszeiten konnten erbeten werden. Am Mittwochabend war für alle Brüder eine Konferenz eingerichtet, geleitet vom Instruktor oder Prior. —Culpaž ist eine Einrichtung, die einmal im Monat stattfand, eine Art der Selbstanklage, wenn man gegen die Regel verstoßen hatte, zum Beispiel das Silentium gebrochen, unnötig viel Wasser oder Energie verbraucht hatte oder gar das Treppengeländer runtergerutscht war. Der alte Abt Placidus war sehr gütig, aber auch konsequent in der Einhaltung der Ordnung, die den Brüdern geringere Rechte als den Patres zubilligte: —Sie sind in den Stand der Brüder eingetreten und nicht, um Pater zu werden.ž Brüder waren Dienstboten. Sie hatten kein Kapitel, also kein beschlussfassendes Gremium, kein Mitspracherecht in innerklösterlichen Belangen. Bruder Egino strebte eine Erneuerung der kirchlichen Kunst an. Egino sagt dazu: —Den Ausdruck —Uniformierte Klosterknechtež prägte ich für uns Brüder, denen gegenüber damals einige studierte Patres ihre Überlegenheit deutlich spüren ließen. Das hat man mir sehr übel genommen. Aber ich hatte mir nichts Böses dabei gedachtž. KLOSTERAUSSCHLUSS Es scheinen mehrere Faktoren zusammengekommen zu sein, die den Konvent 1949 bewogen haben, vierzehn Tage vor der Ewigen Profeß Bruder Egino auszuschließen und ihn trotz seiner Bitte, vielleicht anderswo eingesetzt werden zu können, aus dem Kloster zu entlassen. In dem Konvent wurde von der Mehrheit seine moderne Kunstrichtung abgelehnt. Im Herbst 1948 war er mit der Fertigstellung seines ersten Bischofskreuzes in Verzug geraten. Den Abt hatte er um die Erlaubnis gebeten, abends arbeiten zu dürfen, da er tagsüber keinen Strom habe. Daraufhin wandte er sich an den Elektrizitätsmeister mit der Bitte, ob er ihm Strom zum Emaillieren geben könne. —Ja, gehen Sie heute abend in die Goldschmiede, da sind die Brüder alle im Chorgebet. Ich lasse alle Turbinen laufen und Sie haben genug Strom.ž Auf einmal war ein Donnern im Turbinenraum zu hören. Sein Bischofskreuz war gerade fertig geworden und Egino war zu Bett gegangen. Am nächsten Morgen überbrachte jemand die Nachricht, dass ein Bruder mit seiner wallenden Kutte in die Maschine geraten und zu Tode gekommen war. Egino bat den Abt, in der kommenden Nacht bei dem Toten die Totenwache halten zu dürfen. Das tragische Ereignis hatte die Klostergemeinschaft tief erschüttert. Nach Abschluss des Semesters der Werkschule in Köln brachte Egino selbstverständlich seine Zeichnungen mit und verstaute sie in einem Koffer auf dem Kofferspeicher des Klosters. Eines Tages erschien der Abt: —Bruder Egino, jetzt kommen Sie mal mit. Kennen Sie den Kofferspeicher? Was haben Sie denn alles im Koffer drin?ž —Meine Bilder, meine Aktzeichnungen.ž —So, das wusste ich ja gar nicht, was Sie da malen.ž Die ganzen Aktzeichnungen lagen, von einem Bruder ausgebreitet, da: —Was ist denn das, all das Nackte?ž —Meine Studienmalereienž. —So, so, das haben Sie gemacht? Sonst nichts? Sie wissen ja, daß ich Ihnen verboten habe, Anatomie zu studieren.ž —Das ist keine Anatomie, das sind Zeichnungenž, versuchte er einzulenken. —Ihr Künstler wisst immer was Neues. Räumen Sie die Bilder zusammen, ich möchte nie mehr hören, daß ein Klosterbruder solche Bilder malt.ž Ja, warum sie ihn im Kloster nicht mehr ertragen konnten? Einige merkten, daß ihnen jetzt im Kloster ein Rivale gegenüberstand. Er hatte alle Semesterpreise gewonnen und stand mit seiner Ausrichtung dem üblichen Beuroner- und Nazarenerstil des Klosters entgegen. Er hat damals schöne Bilder gemalt, sehr schöne sogar. Er ist großzügig, schnorrig über die Vorwürfe hinweggegangen. Man hat ihm immer die —Berliner Schnauzež nachgesagt. Im Gespräch beobachteten sie, wie Egino so ungeniert und unbekümmert reagierte, und er kannte einen netten Spruch: —Gibt das Leben dir mal 'nen Buff, dann weine keine Träne, lach' dir 'nen Ast und setz dich druff und wackle mit de Bene.ž Da brach für manche das ganze Korsett ihrer Überzeugungen zusammen. Einige sagten: —Wie bist du weltlich! Du hast keinen Sinn für das Mönchische.ž Die Professoren in Köln lehrten auch abstrakte Kunst, die manchen Patres aber überhaupt nicht gefiel. In den Semesterferien 1948 kam Egino wie immer ins Kloster zurück, emaillierte dort sein erstes Bischofskreuz und malte für jeden Bruder eine individuelle Tischkarte mit weihnachtlichen Motiven für das Festessen im Kloster, vor allem aber Motive für den Kopf des Klosterbriefpapiers, worum der Abt ihn gebeten hatte. Er hatte - anscheinend aber nicht deutlich genug - um Druckerlaubnis gebeten. Als die Briefpapiere - etwa tausend Stück - schon gedruckt und Tischkarten fast schon alle verteilt waren, fragte der Abt ihn, wie er es sich habe erlauben können, im Kloster Bilder ohne Genehmigung zu drucken. Er fühlte sich schuldlos. Er glaubte bei allen Instanzen gewesen zu sein. Es entstand eine erhebliche Aufgeregtheit wegen seines eigenmächtigen Handelns. Alle Karten mußten wieder eingesammelt und diejenigen, die schon beschrieben waren, überklebt werden.  Seine Zeit als Novize war bis zum Ewigen Gelübde zweimal verlängert worden, weil die Patres der Meinung waren, daß jemand, der Kunst studiert, ohnehin bald austreten würde. Er wollte ihnen aber zeigen, daß er trotz abgeschlossenen Kunststudiums seine Gelübde ablegen würde. Als der Termin für seine feierliche Profeß, für sein ewiges Gelübde feststand, wurde im Kloster nach Vorschrift der Regel abgestimmt, ob es Einwände gäbe. Die Abstimmung war vormittags, und nachmittags wurde er zum Abt bestellt. Dieser teilte ihm mit, der Beschluss des Konvents über seinen weiteren Werdegang sei von fünfzig Patres gefaßt worden, die damals über die dreihundert Brüder zu bestimmen hatten. Sie lehnten in der Mehrheit seine moderne Kunstrichtung ab: —Sie sind entlassenž, sagte der Abt, —Sie werden nicht zum Ewigen Gelübde zugelassen.ž Es hatte ein Drittel gegen ihn gestimmt, ein Drittel für ihn und ein Drittel sich der Stimme enthalten. Der Abt wollte auch seiner Bitte nicht nachkommen, wenigstens als Angestellter im Kloster bleiben zu dürfen. Egino wurde gebeten, das Kloster innerhalb von vierzehn Tagen zu verlassen. Einen richtigen Grund für die Versagung des Verbleibens in der Klostergemeinschaft war nicht angegeben worden. Der Abt meinte aber, - offenbar beeinflusst von seinen Kunstkollegen, vor allem Bruder Adelmar, - seine Heiligen sähen aus wie —Idiotenž und es sei auch zu schwer, mit einer Hand im Kloster zu leben. Als Egino das letzte Gespräch mit dem Abt hatte, bevor er weggeschickt wurde, fragte dieser Egino noch, auf einen Tizian zeigend, der an der Wand hing, eine Pietà: —Können Sie das denn auch malen?ž —Was denken Sie, Vater Abtž, sagte Egino wohl etwas überheblich, —das male ich zu jeder Tages- und Nachtzeit.ž Da sagte der Abt: —Ja, jetzt weiß ich es, so einen wie Sie können wir in unserem Kloster nicht gebrauchen. Ich hätte Sie ja nicht weggeschickt, aber die anderen. Jetzt muß ich denen recht geben.ž Während seiner Klosterzeit hatte Egino es nicht erlebt, dass einer ausgeschlossen wurde. Auf die Frage, was hätte er denn im Kloster gemacht, wenn er geblieben wäre. Antwortete Egino, —Ich hätte versucht, es auf den Kopf zu stellen. Ich war nicht einverstanden, daß sie auch vom Betteln lebten. Auch hatte ich Vorstellungen und Ideen, Werkstätten in den Missionen aufzubauen.ž Eine Entlassung war für Egino G. Weinert unvorstellbar gewesen und stürzte ihn in tiefe Traurigkeit, die ihm sein Leben lang gegenwärtig geblieben ist wie seine Liebe zum Kloster. In einem Vortrag über Egino G. Weinert Bruno K. einmal: —Welche Gründe ein Verbleiben im Kloster Münsterschwarzach verhindert und dazu geführt haben, ihm die ewigen Gelübde nicht ablegen zu lassen, ist ein weites Feld und, wie vieles in seinem Leben, unergründlich.ž  DER WEG ZUM SELBSTÄNDIGEN KÜNSTLER Egino fährt in seiner Erzählung fort: Nach meiner Entlassung aus dem Kloster am 16.3.1949 studierte ich weiter an der Kölner Werkschule mit hundertzwanzig Mark Entlassungsgeld in der Tasche. Die mir angebotenen zweihundertvierzig Mark nahm ich nicht an. Die Ausbildung zuvor hatte das Kloster ja ganz getragen und der Cellerar meinte, ich könne mich melden, wenn ich nicht auskäme, aber das Angebot nahm ich nicht an. Ich besaß nur die inzwischen viel zu kurze Manchesterhose, die ich als Vierzehnjähriger beim Eintritt ins Kloster abgelegt hatte. Dazu trug ich bunte Ringelsöckchen, die mir meine Tante Regina auf meinen Wunsch hin aus Wollresten gestrickt hatte. Zuerst wohnte ich, wie schon gesagt, bei den Barmherzigen Brüdern im Bonner Talweg, die mir zum Schlafen eine Badewanne zur Verfügung stellten. Bei meiner Länge wußte ich aber nicht recht, wohin mit den Beinen, und mein Versuch, auf einem Massagetisch zu schlafen, scheiterte, weil ich immer runterfiel. Morgens kamen auch schon um vier Uhr die Brüder, um ihren Dienst zu verrichten. Das war also nichts, ich mußte auch dort bald wieder gehen. Arm wie eine Kirchenmaus schlief ich in Hausfluren, mal hier, mal da bei armen Leuten. Die Mutter eines Kriegskameraden nahm mich auf. Sein Vater war schwer erkrankt und starb einige Tage später. Die Witwe legte Wert darauf, dass ich noch einige Nächte neben dem Toten schlief, damit ihr mit den beiden Söhnen gewisse Wohnungsansprüche nicht verloren gingen. Oder ich verbrachte die Nächte in einem nassen, kalten ausgebrannten Keller am Güterbahnhof, wo ich mit einem Kumpel, dem ein Arm fehlte, Maschinen bewachte, um etwas zu verdienen. Doch da holte mich die Gesundheitspolizei heraus. Es war eine sehr schwere Zeit. Ich bettelte mit anderen an den Haustüren um eine Kartoffel oder ein Stück Brot. Ich suchte nach einer Werkstatt. Aber auch im Kolpinghaus erhielt ich keinen Kellerraum zum Arbeiten zur Verfügung. Irgendwann dachte ich: —Diese Rumgeisterei hat keinen Sinn! Du fährst jetzt nach Bonn und fragst die Leute an der Kronprinzenstraße, das ist die erste Straße am Theater, wo ein Keller zur Verfügung steht, in dem du arbeiten kannstž. Etwas anderes blieb mir nicht übrig, denn ich hatte es versucht, aber mit einer Hand nahm mich kein Goldschmied. Schon im dritten Haus wurde mir ein Keller, unweit des Bahnhofs Bonn auf der Kronprinzenstraße 3 bei einem Orthopäden angeboten, allerdings nicht zum Wohnen. Es war ein Kohlenkeller. Der Kohlenkeller war wunderbar, zwar etwas feucht, aber er wurde ein herrliches Atelier. Zu diesem Keller fanden sogar Bundeskanzler Adenauer, Bundestagspräsident Carlo Schmidt und Finanzminister Schäffer. Wenn ein so hoher Besuch angekündigt war, warf ich ein Tuch über die Kohlen, die ich in den Nebenkeller geschaufelt hatte, und zerschlug die künstlichen Gipsbeine, die aus der Mülltonne des Orthopäden am Kellereingang herausragten. Ich hatte es mir sehr schön gemacht und besaß sogar einen Ofen. Eine Kiste war der Tisch, eine andere diente als Stuhl. Die Wände hatte ich geweißt und mit meinen Bildern vollgehängt. Vorne waren nur kleine Fenster, aber zum Garten hin fiel viel Licht ein durch große Fenster, die ich wieder verglast hatte. Und so habe ich gearbeitet. Da ich bettelarm war, brauchte ich keine Miete zu bezahlen! Ich arbeitete wie besessen, konnte aber nur selten etwas verkaufen. In das Kellerfenster hob ich eine Kiste, auf der ich meine Sachen ausstellte, Kelche, Teller, Patenen und Schmuck, beleuchtet von einer Neonröhre, dazu ein Schild: Goldschmied und Bildhauer Egino Weinert. Frau Professor Treskow suchte mich in der Kellerwerkstatt auf: —Egino, wie wollen Sie mit einer Hand als Goldschmied leben? Obwohl ich zwei Hände habe, konnte ich nicht einmal meine Schuhe besohlen, ich bin auf Schuhen ohne Sohlen gelaufen.ž Ich sagte darauf: —Das werde ich Ihnen zeigen, wie ich das mache.ž Wie, wußte ich aber selber noch nicht. Auf keinen Fall wollte ich Lehrer werden. Sie hatte immer Angst, daß ich ihr ihren Posten an der Kölner Werkschule streitig mache. Denn Professor Hoff war sehr interessiert, mich zu nehmen, weil ich in kirchlicher Kunst versiert war. Er wußte, daß Klosterbrüder eine vielseitige Ausbildung genießen. Professorin Treskow hat den Fehler gemacht, immer ihre Arbeiten durch andere verkaufen zu lassen; sie hat ganz selten selber verkauft. Wenn zwei Mann an einer Sache verdienen, ist der Gewinn minimal. Ich machte sehr schöne Stücke. Eine Buchhändlerin, Anneliese Leopold, meine spätere Frau, die in der Poststraße ihren Laden hatte, konnte ich gewinnen, einige Stücke von mir auszustellen. Das vom Krieg zerstörte Glasfenster war behelfsmäßig durch einen Holzverschlag mit einem Guckfenster aus Glas versehen. Hier stellte sie zwischen den Büchern Arbeiten von mir aus, unter anderem meinen ersten Kelch. Ich machte eine kleine Ausstellung, mit sehr viel Erfolg. Es hatte aber Unwillen an der Werkschule erzeugt, daß ich eine Ausstellung machte, ohne die Genehmigung meiner Professoren einzuholen. Es war Professor Treskow, die einen guten Teil meiner Arbeiten aufkaufte, denn die Sachen waren sehr billig. Als erstes kaufte ich von dem Erlös eine Bohrmaschine, mit der ich auch kratzen konnte, so dass ich mir beim Vergolden mit den Messingbürsten nicht immer in den Armstumpf stach, denn das Zyankali ließ die Verletzung mächtig schwellen. KÜNSTLERBEKANNTSCHAFTEN Frau Professor Treskow stammte aus einer Apothekerfamilie in Detmold. Sie machte eine Ausbildung zur Silberschmiedin. Als sie versuchte, zur Goldschmiedekunst zu wechseln, lernte ich sie in einer Kunstgalerie in Berlin 1939 kennen. Auf einer Ausstellung in Kevelaer sah ich sie später mit vielen anderen Goldschmiedekünstlern wieder, darunter auch Thorn Prikker. Ich bewunderte außerdem Arbeiten der Gebrüder Schwipperts, von denen der eine Architekt, der andere Bildhauer war, Arbeiten von Dinnenthal, Damian und Heim Polens, von dem ich sehr viel lernte. Polens arbeitete drei Monate im Jahr und fuhr neun Monate durch Deutschland, um seine fast ausschließlich religiöse Kunst zu verkaufen. Auch lernte ich hier die ersten Messgewänder von Thorn Prikker kennen, genäht aus Lumpen, aus Sack oder Seide, mit Perlen, mit Holzknöpfen. Später hat man diese Art der Arbeiten in Jugoslawien und Ungarn sehr viel gesehen. Nun weiß man nicht, ob seine Schüler diese Neuheit an die Schulen ins Ausland brachten. Aber ich glaube, Prikker hatte diese neuen Ideen, er war schon immer einfallsreich. Ganz anders war wieder Anton Wendlin, der ganz scharfe statische Linien zog. Er haßte das Verwischen von Bildern; nein, er wollte ganz gerade Linien. Die Glasscheiben hat er nicht einmal bemalt, nur geschnitten und verbleit. So besitze ich von ihm noch ein Kreuz aus Glas. Ihn habe ich auch später einmal aufgesucht und gefragt, ob er mir nicht ein paar Aufträge besorgen könnte, weil ich so sehr arm war. —Achž, sagte er, —junger Mann, ich werde von so vielen Frauen gemolken, ich kann nichts mehr abgeben, ich habe keine Milch mehr.ž Heinrich Lützeler, ordentlicher Professor an der Universität Bonn am Kunstgeschichtlichen Institut, hat 1959 das Buch —Weltgeschichte der Kunstž herausgebracht. Während des —Dritten Reichesž hatte er Schreib- und Redeverbot gehabt. Er lud mich persönlich in seine Vorlesungen an der Bonner Universität ein. Das war damals ungewöhnlich, weil ich kein Abitur vorzuweisen hatte, nur den Volksschulabschluß. Meine Freundschaft mit Professor Mataré von der Düsseldorfer Kunstakademie hielt Pater Urban Rapp aus dem Kloster Münsterschwarzach, der in Bonn Kunst studierte, deshalb nicht für wahr, wovon er seinem Abt Burkhard Utz berichtete. Mataré aber kam oft zu mir in die Werkstatt, wenn er etwas zu machen hatte. Schon früh war eine Studentin von Mataré meine Schülerin. Denn das Sozialamt hatte sie mir empfohlen, da sie durch ihre Schwangerschaft in Nöten war. Wenn er einen tüchtigen Menschen brauchte, kam er zu mir: —Kannst Du mir nicht die L. geben oder komme doch Du selber.ž So kam ich öfter in die Akademie nach Düsseldorf, ohne eingeschrieben zu sein. ERSTE AUFTRÄGE IN DER SCHWEIZ An einem regnerischen Tag, es muß Ende der 40er Jahre gewesen sein, entschloß ich mich, früher als gewöhnlich von der Kunstschule wieder zurück nach Bonn zu fahren. Im Zug saß mir ein Dominikanerpater gegenüber, der, wie sich später herausstellte, Caritasdirektor in der Schweiz war, Pater Leodegar Schaller. Wir waren beide durchnässt. Er erzählte mir, dass er in einem Laden in der Komödienstraße in Köln einen Goldschmied besuchen wollte. Dort habe er aber nur Trümmer vorgefunden. Daraufhin sagte ich: —Sie brauchen nicht mehr lange zu suchen, neben Ihnen sitzt ein Goldschmied.ž Er glaubte mir das aber nicht. Er lud mich im Bonner Bahnhof zum Essen ein. Damals gab es Essen nur abgezählt auf Marken, doch für Schweizer Franken bekam man alles. Endlich einmal satt, lud ich den Dominikanerpater in meine Werkstatt ein, doch er weigerte sich beharrlich mitzukommen. Er befürchtete, wie er mir später sagte, ich würde ihn im Keller umbringen, ich sähe eher einem Verbrecher ähnlich als einem Künstler. Schließlich kam er zögernd mit, und als er im Keller meine Sachen sah, drückte er tausend Schweizer Franken auf den Tisch und sagte: —Alles, was hier ist, gehört nun mir. Sie kommen in vierzehn Tagen zu mir nach Luzern in die Schweiz und bauen dort eine Werkstatt auf.ž Ein Schweizer Einreisepaß und Arbeitspapiere wurden mir bald zugeschickt. Mit einem Diplomaten- und einem Caritasausweis öffneten sich für mich die Schranken der französischen und amerikanischen Besatzungszone. Auf dem Weg nach Luzern machte ich noch in Basel halt und suchte den Künstlerpfarrer der Lukasgilde auf, der mir Plastiken und einiges mehr abkaufte. Pater Leodegar Schaller hatte mir Geld gegeben zum Erwerb eines Führerscheins. Jetzt reiste ich für Dr. Stegerwald und Pater Schaller regelmäßig auf meinem Weg nach Bonn über Frankfurt, das Auto beladen mit billig erworbenen Schuhen und Stoffballen. Prälat Dr. Stegerwald, Sohn des Arbeitsministers zur Zeit des Reichskanzlers Brüning, verkaufte die rahren Schuhe auf dem Markt im Nachkriegsdeutschland und baute von dem Gewinn die Stegerwald-Siedlung in Köln, um die Wohnungsnot in der zerstörten Stadt zu mildern. Über diese Art des Gelderwerbs, allerdings zum guten Zweck, äußerte Kardinal Frings zunächst sein großes Mißfallen. Die Grundstücke waren durch den Einsatz von Bundeskanzler Konrad Adenauer zum Preis für zehn Pfennig beschafft worden. In Luzern waren die Räume schon hergerichtet. Die Werkstatt aber veränderte ich, riss eine Wand heraus, setzte Fenster ein und begann 1949 mit der Einrichtung und einer Ausstellung im Schaufenster. Ich bekam Aufträge in Hülle und Fülle und beteiligte mich an allen Wettbewerben, zu denen mich Pater Schaller ermutigte. Zuerst wohnte ich im Kolpinghaus, wo ich auch Mittag- und Abendessen erhielt. Anschließend bekam ich ein großes Zimmer bei einem Maler im Dachgeschoß. Die Räume für die Werkstatt hatte ein Küster besorgt, der ein Geschäft für Kirchenbedarf an der Stiftskirche unterhielt, mit dem ich zusammenarbeiten musste, und dessen Angestellter ich war, da ich als Deutscher kein eigenes Geschäft führen durfte. Alle vierzehn Tage aber suchte ich meine Werkstatt in Bonn auf, wo schon bald eine Goldschmiedin und mein Studienkollege Weil für mich arbeiteten. Die Buchhändlerin Anneliese Leopold hatte ihren Laden aufgegeben, um meine Kellerwerkstatt leiten zu können. Durch Architekt Boyer erhielt ich 1950 den Auftrag, die Wallfahrtskirche in Lutternbad einzurichten. Darauf folgte eine Reihe anderer Aufträge.  DIE CHRISTOPHERUSPLASTIK Auf dem Hof der Werkstatt, der überdacht war, konnte ich meine Figur aufbauen: einen großen Christopherus, der als Stütze einer ganzen Hausecke geplant war. Zentnerweise brachte ich den Ton auf die Figur. Den Christopherus modellierte ich um ein altes Rohr. Nun musste der Christopherus ein Jesuskind tragen. Das setzte ich oben drauf, und als ich fertig war, sah ich, wie das Jesuskind rutschte. Ich wollte es halten, aber es war so schwer; es drückte mich in die Knie, und mit einem Schlag lag das Jesuskind unten, mindestens zwei Zentner Ton. Als ich alles vorbereitet hatte, benötigte ich einen Helfer zur Fertigstellung. In meiner Not erkundigte ich mich nach einem erfahrenen Gipser. Ja, da müßte ich morgens um vier an die hölzerne Brücke zum Vierwaldstädtersee gehen, da würde ich einen alten Gipser bekommen, sagte man mir. Erst als dieser sah, daß meine rechte Hand fehlte, sagte er zu. Er setzte gekonnt überstehende Drähte in die Figur, rührte Gips an in einer Gummischale, ging um die Figur herum, spritzte sie an und trug den Gips schichtweise auf. Ich mußte Säcke in Gips tauchen und sie an die Figur legen. Eisenstangen brachte er von außen an, die nur an einzelnen Punkten festgemacht wurden. Und dann kam etwas Unerwartetes. Mit den Drähten zerschnitten wir den Gips und konnten so die einzelnen Teile auseinander nehmen und wieder zusammenbauen. Auf diese Weise haben wir die Figur zerlegt und zur Baustelle gebracht, wo der Christopherus aufgebaut werden mußte. Um die Stahlträger herum setzten wir die Gipsschalen und mengten Marmorsplitt und Zement an. Außen war nur noch die Schale, in die der Zement gefüllt wurde. Um schmerzfrei mit dem Hammer die Außenhaut abschlagen zu können, band ich um meinen Armstumpf eine Manschette mit einer Stahlfeder dazwischen, die den Druck auf das Gelenk etwas auffing. Ein paar Tage lang schlugen wir den Gips ab und feilten mit dem Stuckeisen die Oberfläche der Figur, so daß lauter Spitzen entstanden. Sie wurden weiter bearbeitet und glatt geschmirgelt. Der Christopherus, vier Meter hoch, stützt nun den Giebel des Hauses auf dem Wesemlin. Heute ist eine Post darin untergebracht. Trotz aller Aufträge aber hatte ich kein Geld. Ich hatte jeden Monat 1000 Schweizer Franken zur Verfügung. Mein Geld schickte ich zum großen Teil nach Bonn in meine Werkstatt. MEIN BEHINDERTER LEHRLING In Luzern hatte man gehört, daß ich körperbehindert sei. Man fragte mich, ob ich nicht einen Körperbehinderten in meiner Werkstatt beschäftigen könnte. Wenn er eine Arbeitstelle hätte, würde er aus dem Krankenhaus entlassen. Angelino war Halbwaise. Seine Mutter ging als Wäscherin durch die italienische Absperrung, denn sie hatte keine Arbeitsgenehmigung in der Schweiz. Ihr behinderter Sohn war schon seit längerer Zeit im Krankenhaus, weil er einen Nagel in der Hüfte hatte und die Vereiterungen nicht in den Griff zu bekommen waren. Der Junge war dick geworden, konnte kaum laufen und musste sich an den Wänden festhalten. Ich nahm ihn in meine Werkstatt auf und ließ ihn Schälchen treiben. Er war aber so klein, daß er nur mit Hilfe von Kisten an den Schraubstock kam, wo das Metall eingeklemmt werden mußte. Er schwitzte so, daß das Kupfer in seinen Händen oxydierte. Wir mußten es immer wieder abwaschen, weil soviel Grünspan und Schweiß entstanden. So dick war Angelino. Ich kaufte ihm ein Fahrrad, doch er wollte nicht fahren. Auf das Ding setze er sich nicht drauf. Wir schoben ihn auf den Wesemlin und dachten, den Berg hinunter wird es schon irgendwie gehen. Wir hielten ihn fest. Plötzlich aber bekam er Tempo. Wir konnten nicht mehr mitlaufen. Der Junge raste bergab. Glücklicherweise passierte nichts. Von da an war er ein begeisterter Fahrradfahrer. Ich wollte einen Lehrvertrag abschließen, aber der Junge hatte durch den langen Krankenhausaufenthalt keine abgeschlossene Schulbildung. Deshalb lehnte die Schweizer Innung einen Lehrvertrag ab. Bei der Kölner Innung fragte ich nach, ob sie unter diesen Bedingungen einen Lehrvertrag gestatten würden, er könne ja lesen und schreiben. Den in Köln genehmigten Lehrvertrag legte ich in Luzern vor. Die Schweizer gaben nach. Der Junge aber wurde immer dünner. Nach zwei Jahren war meine Arbeitsgenehmigung in der Schweiz abgelaufen, und ich mußte die Schweiz verlassen. Meine Werkstatt übernahm mein Nachfolger Werner Röhrig. Nach Jahren kam ich zurück nach Luzern und durchsuchte das Telefonbuch nach der Adresse von Angelino Piazze. Ich fand die Haustüre und klingelte. Es öffnete ein stattlicher junger Mann, den ich nach dem ehemaligen Lehrjungen fragte. —Ich bin es doch, Egino!ž Er hatte eine eigene Goldschmiede in der Stadt, war verheiratet und hatte gerade Mittagspause. Auch suchte ich das bekannte Goldschmiedegeschäft Gübelin auf, in dessen Auslagen ich Puderdosen aus purem Gold stets bewundert hatte. Viele Jahre hatte mir der Kollege geholfen, schöne Ölgefäße und Schmuck herzustellen und nach meinen Entwürfen Nielloarbeiten zu fertigen. Wenn man Silber, Kupfer und Blei zusammenschmilzt, ergibt es eine Art Emaille. (Eine schwärzliche Legierung aus Silber, Kupfer, Blei, Schwefel und Salmiak, die in eine gravierte Zeichnung eingeschmolzen wird, so daß sich diese durch den anderen Farbton oder Helligkeitswert von der glänzend polierten Metallfläche abhebt. Mittlerweile hatte Meister Gübelin von einem Uhrmacher den alten Laden übernommen: Er würde lieber Uhren als Kunst verkaufen, da wüßte er, was er hätte, meinte Gübelin. DAS KELLERATELIER IN BONN I950-1956 ELLA BROSCH - EINE UNTERNEHMERIN GROßEN STILS Schon bevor ich aus dem Kloster entlassen worden war, hatte ich von der Kunstzeitschrift der Ella Brosch gehört, die in der jetzigen portugiesischen Botschaft in Bad Godesberg eine Schule für Paramentik (stoffliche Gestaltung liturgischer Gewänder) gegründet hatte. Durch ihre Ideen und Initiative entstand nach dem Ersten Weltkrieg ein reges Gemeindeleben in den Pfarreien. Um Kontakt zu ihr zu bekommen, fuhr ich nach Bad Godesberg. Im Kloster hatten wir viel gelesen. Aber als ich alle Bände der Kirchenväter in weißem Pergament in ihrem Regal stehen sah, diese Wohnung, dieses schloßartige Haus am Rhein, da bin ich fast in die Knie gerutscht. Sie war eine fromme und gebildete Frau, hatte aber auch Haare auf den Zähnen. Um diese Zeit wurde Bonn Sitz der Bundesregierung. Sie wartete, bis der Preis für den angestrebten Erwerb ihres Hauses ihr gemäß erschien und verkaufte ihr Haus. Das Geld setzte sie für zwei Klöster ein. Auch in das Kloster Dachau steckte sie viel von dem, was sie verdiente. Mir gab sie die ersten Aufträge für Chormantelschließen, Bischofskreuze und anderen Kirchenschmuck. Ganz arm in meinem Kelleratelier fing ich an, Lavabokännchen zu machen, ein Wein- und ein Wasserkännchen mit einem Deckel und einem Teller, den ich aber in Solingen machen ließ, vernickelt und verchromt, also gestanzt. Die ganze Garnitur bot ich der Aachener Missionsgesellschaft an für 27 DM. Das war 1950. Was machen die? Bestellen 1000 Stück, 1000 Garnituren! Nun konnte ich arbeiten. Auch bekam ich Weihrauchfässer und Aspergile in Auftrag (Geräte zum Sprengen von Weihwasser). In Rom gibt es eine Fahnenfabrik, die auch in Bonn eine Niederlassung hatte. Meßgewänder, die Ella Brosch an die Missio lieferte, waren hier hergestellt worden, für achtzehn Mark pro Stück. Ich hatte sie einmal nach Bremen begleitet. Da gab es ein großes Lager in ehemaligen Scheunen: Ballen an Ballen mit Rohseide, die schönste handgewebte Rohseide bis zur Decke gestapelt. Sie hatte Waggons voll Ballen gekauft und sie in Krefeld in einer Färberei färben lassen. Der Quadratmeter Seide kostete sie sechs Mark, und sie verkaufte das Meßgewand für achtzehn Mark. Professor Wendlin in Aachen gewann sie für die Idee, Stäbe dafür zu entwerfen. Die Meßgewänder wurden früher nämlich bestickt. In einer Wuppertaler Fabrik sah ich einmal, wie eine Reihe Holzplatten übereinandergelegt wurden zum Einfräsen von Mustern. Eine Maschine stickte Muster auf die Stäbe, die später aufgenäht wurden. Sie verkaufte diese Stäbe für neun und 12,50 DM pro Meter. 1952 wurde Ella Brosch eine Professur an der Kunstschule für christliche Kunst in dem französisch besetzten Saarbrücken angeboten, wohin sie mich auch empfahl. Aber mit der lehrenden Tätigkeit war ich nicht einverstanden. Zu der Zeit bekam ich den Auftrag, das dortige Priesterseminar einzurichten. Einige Jahre später, als nach der Rückgliederung des Saarlands 1956 die Kunstschule aus politischen Gründen aufgelöst wurde, zog Ella Brosch nach Denia in Spanien, wo sie sich ein Haus baute. MEINE HEIRAT MIT ANNELIESE LEOPOLD Über ein Jahr liefen meine Gesuche, um in anderen Klöstern Aufnahme zu finden. Es ist nicht ohne weiteres möglich, von einem Orden in den anderen zu wechseln. Ich erhielt nur abschlägige Bescheide. An dem Tage aber, als ich mich mit Anneliese Leopold verlobte, traf die lang ersehnte Zusage der Franziskaner von Waldbreitbach ein. Jetzt aber waren die Würfel gefallen. Wie ich sie näher kennengelernt habe? Ich merkte bei der Ausstellung in ihrem Buchladen, daß sie Gefallen an meiner Person fand. Sie war eine wunderschöne, intelligente Frau. Sie hatte mit Lotte Adenauer, der Tochter des Bundeskanzlers, dieselbe Klasse in einer Klosterschule besucht. Meine Schwiegermutter war gleichzeitig mit Adenauer in Köln im Gefängnis auf dem Messegelände in Haft gewesen. Sie, eine hoch angesehene Frau, Mutter von fünf Kindern in Bonn, saß damals ein wegen antinationalsozialistischer Äußerungen. Die Eltern von Anneliese besaßen eine Buchdruckerei. Sie selbst hatte ein Lehrerexamen absolviert. Zu dem Zeitpunkt liefen meine Aufnahmegesuche bei verschiedenen Orden. Ich wollte unbedingt in ein Kloster. Eines Tages, als ich alle Hoffnung aufgegeben hatte, jemals wieder in einem Orden aufgenommen zu werden, bat ich Fräulein Leopold, ob sie vielleicht mal mit mir ins Kino ginge, denn ich hatte gehört, daß man das so mache. Als ehemahliger Klosterbruder hat man ja von solchen Dingen keine Ahnung. Sie stimmte erfreut zu. —Aberž, sagte ich ihr, —ich habe kein Geld für die Eintittskartenž. Sie kaufte die Karten. Nach dem Besuch des Kinos gingen wir noch am Rhein spazieren. Ich fragte sie, ob sie meine Frau werden wolle. —Jaž, sagte sie nach einigem Bedenken, —aber ich glaube, das geht nicht. Ich bin für Sie nicht fromm genug.ž Meine Arbeitserlaubnis in der Schweiz war im Januar 1951 abgelaufen. Jetzt drängte Anneliese zur Heirat, obwohl ich ihr klarmachte, daß die finanzielle Lage trotz aller Schufterei es nicht erlauben würde. Als ich meine Braut Abt Burkhard Utz in Münsterschwarzach vorstellte, meinte er: —Passen Sie gut auf den Egino auf, das ist ein leichtsinniger Vogel.ž Eines der Bilder, gemalt in der Werkschule zum Thema —Mädchen mit rotem Pož tauschte ich aus Armut gegen einen Hochzeitsanzug mit Zylinder. Noch bis spät in die Nacht vor der Hochzeit lötete ich die Bronzeteile und emaillierte ihre Brautkrone fertig. Nach der Hochzeit im Kölner Dom haben wir bescheiden auf dem Studentenzimmer eines Freundes gefeiert. Ende September 1951 wurde unser erstes Kind geboren: Gisela. Da Anneliese keine Wohnung besorgen wollte, wandte ich mich an den heiligen Josef um Fürbitte. Die Novene, das ist die Verrichtung bestimmter Gebete an neun aufeinanderfolgenden Tagen, beliebt seit dem 17. Jahrhundert in Notlagen, hatte ich noch nicht beendet, da erschien kurz darauf der Pfarrer Malangré von Schwarzrheindorf, der mir kurz zuvor meinen ersten Kelch abgekauft hatte, und bot mir ein leerstehendes Pfarrhaus für 20.000 DM zum Kauf an. Wir einigten uns auf eine Miete von zwanzig Mark. Zu meiner Werkstatt fuhr ich täglich zurück über den Rhein. Zu der Zeit bekam ich einige Aufträge von Kardinal Frings. Schon 1951 hatte ich für ihn unter anderem einen sehr schönen Tabernakel gestaltet. In Bonn hatte ich ein Jahr zuvor mit dem Glasmaler Professor Schaffrath, der aus Alsdorf bei Aachen stammte, eine Kirche eingerichtet.  IN DER NUNTIATUR Eines Tages erschien, kurz nach der Geburt von Gisela, Prälat Haag, früherer Sekretär von Nuntius Pacelli, dem späteren Papst Pius XII. (1939-58), der von mir gehört hatte, in meinem Kelleratelier. Er lud mich nach Bad Godesberg ein, um die Nuntiatur, die ständige Vertretung des Vatikans im Ausland, ganz einzurichten. Das Gebäude war während der Kriegszeit als BDM-Schule für die Hitlerjugend umfunktioniert worden. Er hatte den späteren Erzbischof Heim in die Nuntiatur geholt, mit dem Auftrag, diese wieder aufzubauen. Ich hatte von Kardinal Münch den Auftrag, eine Kapelle zu bauen, wo der Altar als Berg Golgotha dargestellt werden sollte. Lauter Stufen und oben ein ganz kleiner Altar, ein großes Kreuz - und darüber hinaus der Kelch, Jesus am Kreuz, dazu Maria und Johannes. Er wollte den Longinus zum Schluß dargestellt haben mit großem Altarbild, den Rücken zum Volk gewandt. Ich war der Ansicht, daß der Kelch in die Mitte gehöre. Ein Gedanke, den ich von Romano Guardini und dem Architekten Schwarz aufgenommen habe, die in die Mitte des Saales einen Tisch stellten, um das Mysterium mit der Gemeinde ringsherum feiern zu können. Das Abendmahl ist ja eine Vorwegnahme des Kreuzigungstodes Jesu. Durch die Bekanntschaft mit der Nuntiatur, in der ich zwei Kapellen einrichtete, entstanden Verbindungen ins Ausland. Ich lernte den Nuntiaturrat und späteren Erzbischof Dr. Bruno Heim kennen, der bis 1952 Sekretär bei Nuntius Roncalli, dem späteren Papst Johannes XXIII. (1958-1963), gewesen war. Sein erster Auftrag war ein kostbarer Kelch. Er beauftragte mich, als er Nuntius in Kairo, später in Kopenhagen und dann in London wurde, mit der Gestaltung und Einrichtung seiner Kapellen in den Nuntiaturen und mit Kirchen in Skandinavien, Dänemark, Grönland und Island. In der Nuntiatur lernte ich auch den späteren Kurienkardinal Ratzinger kennen. In Bonn wurde ich mit der Einrichtung der neu erbauten Kirche St. Michael zusammen mit dem Architekten Kleefisch beauftragt. BUNDESKANZLER KONRAD ADENAUER BESUCHT DIE KELLERWERKSTATT 1951 Konrad Adenauer kam mit Polizeibegleitung angefahren und wollte ein Ölgefäß für einen Priester, nämlich seinen Sohn erstehen. Damals hatte ich meine Werkstatt noch im Keller von Dr. Richartz, dem Orthopäden. Im Eingang zu meiner Werkstatt stand seine Mülltonne, aus der die abgelegten Gipsarme und -beine seiner Patienten noch teilweise herauslugten. Dr. Richartz war gerade dabei, die Gipssachen einzustampfen, damit sie in die Tonne paßten. Als der hohe Gast eintraf, übersah er die Tätigkeit des Arztes freundlich und sagte zu mir: —Ich hätte gerne ein Ölgefäß für meinen Sohn.ž Ich bot ihm ein wunderschönes Ölgefäß an, verziert mit Emaille für 250 Mark. —Das ist viel zu viel Geldž, sagte er. —Haben Sie nicht ein billigeres?ž —Ja, für 120 Mark. Das ist aber nicht so schön gearbeitet und dünner.ž Darauf der Bundeskanzler: —Das ist aber noch viel zu teuer, mein Sohn braucht das doch nicht jeden Tag!ž —Ich habe auch noch eines für 32 Mark, das ist aber nur versilbert und hält bestimmt nicht so gut. Aus Zinn habe ich auch noch eines, aber wenn das herunterfällt, ist eine Beule drin. Für die Mission habe ich Ölkännchen hergestellt, da kostet eines acht-Mark-fünfzig.ž Adenauer: —Das ist das Richtige, das nehme ich.ž Ich meinte darauf: —Herr Bundeskanzler, dafür fährt man doch nicht mit Blaulicht hierher, wenn es um das billigste für acht-Mark-fünfzig geht.ž Er erwiderte: —Auf der Brüsseler Weltausstellung 1951 habe ich von Ihnen einen Ring und ein Kreuz erstanden. Ist das denn nichts? Übrigens in einem Brief wurde ich aufgefordert, anläßlich der Eröffnung einer Kirche ein Kreuz zu stiften. Herr Weinert, haben Sie ein Kreuz für 250 Mark da?ž —Ja, ein Militärkreuz.ž Das sagte ihm gleich zu. Später bekam ich durch ihn manch gute Aufträge.  —MALE SO, WIE DU GLAUBSTž Ja, ich hatte immer das Gefühl, aus meiner Armut herauszukommen. Schwiegermutter Leopold wollte uns Geld geben für ein Haus, aber Anneliese wollte nicht. Auch ihr Onkel wollte uns finanziell aushelfen. Im Grunde habe ich mich nicht irritieren lassen, habe weiter gearbeitet, von morgens früh bis abends spät. Ich war so glücklich in meiner Kellerwerkstatt, und die Arbeiten waren schön. Annelieses wachsende Unzufriedenheit merkte ich nicht, ich war so verliebt. In dieser Zeit erwarteten viele von mir, daß ich mich dem Trend der Zeit anschließen und nur noch abstrakte Kunst machen würde. Auch das Generalvikariat erwartete von mir abstrakte Malerei. Ich war mir nicht mehr sicher, in welcher Kunstrichtung ich arbeiten sollte. Da war mir die Botschaft einer Stigmatisierten, die mir überbracht wurde, eine entscheidende Hilfe: —Male so, wie du glaubst.ž Es war Therese von Konnersreuth, mit der ich Zeit meines Lebens nie in Kontakt getreten bin, die aber 1952 in einer Vision mein Leben gesehen und Bischof Esser, der zur Beerdigung seiner Mutter aus Afrika angereist war, unter anderem voraussagte, daß ich ein schweres Leben mit meiner Frau haben würde. Ich aber glaubte das nicht, denn ich war sehr verliebt in meine Anneliese und merkte nicht, daß sie sich innerlich schon von mir abgewandt hatte. Dem Bischof, der mich zuvor mit seinem Vetter, dem Kolpingpräses Ridder, in meiner Werkstatt aufgesucht hatte, gab sie den Auftrag, er solle mir auch mitteilen, ich solle so malen und gestalten, wie ich glaube. Das war der wichtigste Satz für mich. Denn ich war ja vorher von Künstlerkollegen meines Klosters und dem Abt darauf aufmerksam gemacht worden, meine Heiligen sähen so merkwürdig aus. Auch hatte Therese gesagt, ich würde soviele Kreuze machen wie niemand zuvor. Eine Aussage, mit der ich nichts anzufangen wußte. Aber dann überkamen mich immer Ideen, ob am Strand von Denia oder auf der Terrasse oben, Ereignisse aus dem Neuen Testament auf der Kreuzoberfläche plastisch sichtbar zu machen. Das fand und findet viel Anklang. Inzwischen sind es weit über dreihundert Kreuzmotive. Viele Jahre später bekam ich den Auftrag, für die Hauswand von Thereses Wohnhaus in Konnersreuth eine fast metergroße Darstellung der Stigmatisierten als Emaillebild zu gestalten. Ich bin bei den Studien zu meinen Bildern vielen Stigmatisierten begegnet, die heute vergessen sind. Sie haben dieses Leiden in der Stille, in der Einsamkeit durchlitten. Soweit zunächst der Bericht von Egino. Er träumt sehr viel und zwischen Wachen und Schlafen ist ihm, als würden die Heiligen mit ihm reden und sich freuen, durch seine Arbeiten nicht in Vergessenheit zu geraten. Beim Modellieren fallen ihm oft die Geschichten von Heiligen ein, die er dann unmittelbar umsetzt. E.G.W.: —Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, wir leiden nicht jeden Tag. Es gibt immer etwas, was uns Unzufriedenheit bereitet. Das Miteinander, dass zwei Menschen zusammen auskommen müssen oder die Begegnung mit anderen. Ich meine, hier bei den Stigmatisierten ist aber die Gnade Gottes oder die Liebe Gottes in einer besonderen Weise sichtbar geworden. Manche Menschen sind natürlich noch nicht von dem Glück der Erlösung erfaßt. Wie wenige wissen etwas von der Erlösung, von dem Heil, das uns Jesus gebracht hat. B.: —Manchen Leuten geht es gut. Sie wissen nicht, von was sie erlöst werden sollen.ž E.G.W.: —Und wie lange habe ich gebraucht, bis ich das erfahren habe. Ich habe das auch nicht von heute auf morgen geschafft. Ich muß sagen, je älter ich werde, desto mehr entdecke ich immer wieder etwas Neues vom Geheimnis der Erlösung. Kennst du den Ausspruch aus dem Evangelium: —Wer mich sieht, sieht auch den Vater?ž Wer den Vater nicht sieht, der sieht gar nichts. Der hat also überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Und dieser merkwürdige Satz von Petrus, als die meisten Jünger weggegangen waren und nur noch die Zwölf da standen, und Jesus sie fragte: —Wollt Ihr auch gehen?ž antwortete Petrus: —Ja, wo sollen wir denn hingehen? Wir würden ja auch ,abhauen', wir wüßten aber nicht, was wir tun sollen. Wir haben geglaubt und erkannt, daß Du der Heilige Gottes bist.ž Petrus hat etwas Gewaltiges gesagt.ž E.: —Und weshalb wollten sie alle gehen?ž B.: —Jesus war ein richtiges Ärgernis.ž E.G.W.: —Ich werde euch mein Fleisch zum Essen geben und mein Blut zum Trinken.ž B.: —Und das bei den Juden.ž  DIE VISION DER STIGMATISIERTEN THERESE UND IHRE VORAUSSAGE Egino berichtet weiter: In der Fastenzeit - vielleicht war es 1952 - kam, wie schon gesagt, in meine Kellerwerkstatt in Bonn Bischof Esser aus Südafrika, Headman-Coek, gebürtig aus Opladen, den ich noch nicht kannte. Ihn begleitete der mir bekannte Generalpräses Dr. Ridder vom Kolpingwerk. Der Bischof hatte einen Auftrag für mich. Er wollte aus einem Schmuckstück seiner verstorbenen Mutter ein Bischofskreuz anfertigen lassen. Es war ein gestanztes Kreuz aus der Zeit um 1919, ganz dünnes Blech. Die Mutter hatte es ein Leben lang getragen, die Ecken waren abgenutzt. Er versuchte mir vorzuschreiben, wie das Kreuz auszusehen hätte und legte mir eine Art Kuhkette aus Gold hin. Tausend Mark wollte er mir für diese Arbeit dazugeben. Ich dagegen schlug ihm eine zeitgemäßere Form vor, um die ich mich mit meiner Kunst und in der Arbeit für die Kirche bemühte. Das gefiel dem Bischof nun ganz und gar nicht. Er wünschte sich das Kreuz in alter barocker Form mit vielen Edelsteinen. Im Laufe des Gesprächs zeigte Bischof Esser Bilder von Therese Neumann aus Konnersreuth, (die er dort wieder hinbringen sollte, nachdem Mitbrüder aus seinem Orden der Salesianer sie unerlaubt in die Mission nach Afrika mitgenommen hatten). Die Bilder zeigten Therese im Freitagsleiden mit den Wundmalen Christi, das Gesicht blutüberströmt, im Bett liegend. Ich war sehr erschrocken. Der Bischof äußerte sich aber sehr kühl und zurückhaltend. Er stand den Geschehnissen um Therese Neumann sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber. Er betonte vor allem gegenüber Generalpräses Dr. Ridder seine Weltoffenheit und ließ ihn erkennen, daß er nicht viel von Wundergeschehen hielt. Der Bischof bezweifelte die Geschehnisse um Therese. Ich konnte mir aber nie ein Bild machen vom Blutschwitzen. Von Christus wird im Evangelium berichtet, er habe Blut geschwitzt. Ich dachte, das sei bildlich gemeint. Es hat mich zutiefst erschüttert, wie Therese von Konnersreuth blutüberströmt abgebildet war. Der Bischof führte das Gespräch weiter und versuchte mich umzustimmen, das Kreuz doch zu machen in der von ihm gewünschten Form. Es kam zu einem Wortgefecht. —Sie haben gar nicht honoriert, daß wir hergefahren sind aus Köln, um Ihnen mit einem Auftrag zu helfen. Wissen Sie, bei mir wären Sie achtkantig aus dem Kloster geflogenž, wobei er mich zuvor bedauert hatte, mit einer verstümmelten Hand aus dem Kloster entlassen worden zu sein. Kurzerhand packte er alles wieder ein. Aus dem Auftrag für das Brustkreuz wurde zunächst nichts. Das war kurz nach Aschermittwoch. Am folgenden Karsamstag wurde ich zu Bischof Esser nach Leverkusen bestellt, der inzwischen in Konnersreuth und Münsterschwarzach gewesen war. Er kam herein, begrüßte mich und sagte, er müsse sich entschuldigen und bat, unsere letzte Auseinandersetzung zu vergessen. —Ich muß Ihnen etwas erzählenž, sagte er und überreichte mir mit feierlicher Geste ein blutbeflecktes Tuch. —Jaž, sagte er, —das gehört Ihnen. Das hat Ihnen Therese geschenkt. Sie kannten meine Einstellung.ž Nun erzählte mir der Bischof, was sich inzwischen ereignet hatte. Als er in Fockenfeld bei Konnersreuth die Bilder zurückgeben wollte, bat man ihn, es war gerade Freitag, die Heilige Messe im Zimmer von Therese zu lesen. Als er in der Meßfeier bei der Kommunion angelangt war und ihr die Heilige Kommunion reichen wollte, nach dem —ecce agnus deiž, verschwand plötzlich die Hostie aus seiner Hand. Therese hatte sie - ohne erkennbare Schluckbewegung - in sich aufgenommen. Auf die Möglichkeit eines solchen Geschehens war er, wie er mir erzählte, zuvor schon von seinen Mitbrüdern hingewiesen worden. Nach dem Kommunionempfang versank Therese, berichtete der Bischof weiter, in Ekstase. Als er Therese in ihrem abgehobenen Zustand liegen sah, kam ihm der Gedanke, sie auch zu fragen, was es denn mit dem Künstler in Bonn - damit war ich gemeint - so auf sich habe. Er hatte eine Visitenkarte von mir in der Brusttasche und wollte auf dieser gerade meinen Namen nachlesen. Im selben Augenblick aber gab ihm Therese ihr blutdurchtränktes Kopftuch und sagte: —Bringen Sie das dem Egino Weinert nach Bonn.ž Der Bischof meinte, als die Sprache auf mich kam, es handele sich wohl um eine Gedankenübertragung zwischen ihm und Therese. Er wollte der Sache auf den Grund gehen und prüfen, ob tatsächlich eine Vision vorlag. Er nahm eine brennende Kerze vom Altar und hielt sie ihr unter die Hand. Aber Therese zeigte keine Reaktion. Sie sagte: —Bestellen Sie einen schönen Gruß vom Heiland, Egino soll nicht mehr traurig sein. Der Heiland hat ihn besonders lieb.ž Bischof Esser berichtete weiter, Therese habe ihm aus Eginos vergangenem Leben erzählt. Sie erwähnte ein Gespräch, das der Heiland mit dem Teufel über Egino geführt habe. Der Teufel habe zum Heiland gesagt, er wolle sein Leben. Da hätte der Heiland gesagt: —Nix da, er muß noch viel für mich arbeiten.ž Darauf habe der Teufel gesagt: —Dann will ich seine rechte Hand!ž Der Heiland habe gesagt: —Die kannst du haben. Und ich werde dir zeigen, wieviel er für mich auch mit nur einer Hand arbeitet, besonders über mein Kreuz, so viel wie noch nie jemand vor ihm. Er wird damit sehr berühmt werden.ž Darauf habe der Teufel entgegnet: —Der ist ja nur fromm, weil er im Kloster ist. Aber wenn ich ihn aus dem Kloster nehme, fällt seine ganze Frömmigkeit zusammen wie ein Kartenhaus.ž Darauf habe ihm (dem Teufel) der Heiland die Erlaubnis gegeben, aber gesagt, er werde auf Egino aufpassen bis an das Ende seines Lebens. Egino werde ein sehr schweres Leben ... haben und sagte noch einiges mehr über sein Leben voraus. Der Bischof sagte noch: —Herr Weinert, Ihr nächstes Kreuz mit Ihrer Frau, das wird so schwer, daß Sie darunter zerbrechen.ž Soweit der Bericht von Egino.  Das konnte Egino nicht verstehen, denn er war sehr verliebt in seine Anneliese, und er nahm auch nicht an, daß beider Leben schwer werden würde. Der Bischof fuhr in seinem Bericht fort, der Heiland werde aber bis zum Ende von Eginos Leben wachen... Vor allem aber sollte er nur das malen und gestalten, an das er glaube. Egino bemerkte dazu, —er könne sich persönlich nur schwer vorstellen dass der Heiland mit dem Teufel ein Gespräch führe, er gäbe aber wieder was der Bischof über die Äusserungen von Therese berichtet hat...ž Die Aufforderung er solle nur das malen und gestalten an das er glaube war der wichtigste Satz für ihn. Denn er war ja vorher vom Abt seines Klosters unter anderem darauf aufmerksam gemacht worden, seine Heiligen sähen aus wie Idioten, worüber er verwirrt war. Auch an der Kunstakademie wurde fast nur noch abstrakt und ornamental gearbeitet. Von der Diosösan-Kunstabteilung wollte man ihm keine Aufträge mehr geben, wenn er das figürliche Gestalten nicht ließe. Er solle nur ornamentale Formen benutzen, wobei er aber doch ein ganz anderes Gestaltungs- und Aufzeigebedürfnis hat. Auch sagte der Bischof, Anneliese würde vom Glauben abfallen und wenn der Heiland nicht selber eingreifen würde, würde sie verloren gehen. Diese Aussage fiel Egino erst wieder ein, als Anneliese auf ihrem Sterbebett mit dem letzten Atemzug um einem Priester rief. Um Thereses Aussagen zu prüfen, fragte Bischof Esser: —Sag mal, Resel, wieviel Kühe habe ich in Afrika?ž Und sie nannte ihm alle Kühe, die er besaß, und riet ihm, eine Kuh abzuschaffen, die nicht gut sei. Der Bischof lebte nämlich von den Einnahmen des Stalls. Als er Therese weiter über Egino befragen wollte, riet sie ihm, er solle sich im Kloster Münsterschwarzach erkundigen. Als der Bischof sie nach ein paar Stunden in Begleitung ihres Betreuers, des Pfarrers Naber, wieder aufsuchte, konnte sie sich an nichts mehr erinnern, was typisch für die Art ihrer Visionen war. —Haben Sie keine Lust, zu mir nach Afrika zu kommen?ž, fragte Bischof Esser den Künster Egino. —Ja, würde ich sofort machenž, antwortete er. —Aber das geht ja nicht, Sie sind verheiratet. Überdies hat mir die Therese gesagt, Sie würden nach Köln gehen.ž Er erteilte ihm den Auftrag, sein Bischofskreuz ganz nach Eginos Vorstellungen zu gestalten. Auf seine Bitte hin gab Egino ihm das Kopftuch der Therese mit für seine Gemeinde in Afrika, ein Tuch mit den Blutflecken einer Dornenkrone. B.: —Was ändert sich durch eine Selig- oder spätere Heiligsprechung, die, wie ich höre, von einem Kreis von Leuten seit Thereses Tod (18.9.1962) angestrebt wird?ž E.G.W.: —Dass diese Sache nicht in Vergessenheit gerät. Ich habe viele Stigmatisierte durch mein Bücherstudium kennengelernt, die dieses Leiden in der Stille durchlebt haben. Ich meine, hier ist aber die Gnade Gottes in besonderer Weise erkennbar geworden. Auch das Bemühen für die armen Seelen, die Verstorbenen, das Therese anmahnte, halte ich für enorm wichtig. Denn wir sind auf sie angewiesen, die im Himmel vor dem Heiland für uns bitten, daß uns die eine oder andere Gnade, derer wir bedürfen und die wir von uns aus nicht erwerben können, geschenkt wird, uns oder unseren Kindern oder irgend jemand anderem.ž Das, was er von dieser Stunde an von der Therese wußte, war ihm Halt für sein ganzes zukünftiges Handeln und sein Leben. NEBEN MEINER ARBEIT: BETTELN GEHEN Fortsetzung des Berichts von Egino: Es kamen wirtschaftlich schwere Zeiten für uns. Unser zweites Kind Clemens wurde uns im September 1954 geschenkt. Inzwischen hatten wir eine Wohnung neben der Werkstatt beziehen können. Wir hatten die ersten zwei Kinder, doch ich mußte neben meiner Arbeit immer noch betteln gehen. Mittags gaben mir die Barmherzigen Brüder Essen für die Familie. Wir hatten damals pro Monat für Miete und Lebensunterhalt 180 bis 240 DM, obwohl Anneliese mitarbeitete. Nachts fuhr ich zwischen Auftraggebern hin und her, vorbei an Misthaufen, Rübenkarawanen, kilometerlangen Schlangen vor Bahnübergängen, denn damals gab es noch kein Autobahnnetz; oft schlief ich nachts an Tankstellen. Ich war jung und drahtig, besuchte die Pfarrer, meine Kinder waren immer dabei. —Schon wieder eine Kirche!ž stöhnten meine Kinder. Gaststätten waren zu teuer. Es gab nette Priester, die das einsahen. St. Thomas in der Eifel oder Kolping in Oberhundem. Für Anneliese war dieses Leben eine große Belastung. Sie fuhr in den ersten Jahren mit und unterhielt die Kinder mit Pilzesuchen oder Schlittenfahren, während ich mit dem Einrichten von Kirchen beschäftigt war. —FRINGSENž In unserer Werkstatt arbeiteten wir zu der Zeit hauptsächlich für Angehörige der amerikanischen Besatzungsmacht. Sie zahlten mit Dollar; ein Dollar bedeutete für uns 4,20 DM. Nach 1946 fuhren Züge vollgeladen mit Kohle nach Frankreich. Wir alle aber froren. Die Leute, die in Bonn am Bahnhof Kohlen klauen wollten, wurden erschossen. Da setzte sich Kardinal Frings für die arme frierende Bevölkerung ein. —Wenn sie die Kohlen nicht bekommen können, müssen sie die sich nehmen.ž In aller Munde war plötzlich das Wort —fringsenž. In dieser Zeit fingen die Gewerkschaften in der Kohleindustrie an zu wirken. Die Arbeiter streikten in den Bergwerken und pochten auf Lohnerhöhung. Der Stundenlohn von 2,40 Mark stieg auf 3,60 Mark. Wir dachten uns, wenn das so anfängt, ziehen die eisenverarbeitende Industrie, die Textilindustrie und alle anderen nach. Wir kannten die Situation aus Amerika. Ich schickte damals schon mal Bilder nach Amerika. Doch musste man aufpassen, wem man sie in die Hand drückte. Manches Mal verschwand die Sendung einfach auf dem Weg dahin. Oft hieß es: —Das Schiff ist auf Grund gelaufenž, oder —es gab einen Havarieschadenž, das bedeutete, man musste die Sachen wieder loskaufen. Mit Amerika zu arbeiten war sehr schwer. Man mußte selber fahren, um die Sachen hinüberzubringen. Zum Glück studierten amerikanische Studenten in Bonn. Die Verbindungsfäden verliefen unvorhersehbar. Pfarrer Matt, ein Freund, kannte zum Beispiel eine Frau in Brüssel, die wiederum einen Jesuitenpater in Japan, auch Kardinal Münch hatte enge Fäden nach Amerika. Durch den Einfluß von Pfarrer Leo Schmitz aus Rosenheim bei Betzdorf konnte ich auch dort eine Reihe Kirchen in seiner größeren Umgebung einrichten. Ähnlich erging es mir in Neumarkt (Pfalz), wo Architekt Meier mich bekannt machte. In Kirchweiler: keine Gaststätte, kein Hotel, aber Pfarrer Leo Schmitz wußte immer Rat. Er war noch Kaplan, als er nach einem Einkauf in meiner Werkstatt mit dem Motorrad schwer verunglückte, so dass er querschnittgelähmt blieb. Sein Engagement als behinderter Pfarrer in seiner Gemeinde führte hier in seinem Umfeld, ähnlich wie beim Pfarrer von Kalterherberg, an die zwanzig junge Menschen zum Priesterberuf, darunter zählt auch Professor Ronig. Wir haben gehungert, Anneliese hat mitgehungert. Zwei Jahre lang habe ich gebettelt. Aber sie konnte diese Art zu leben auf Dauer nicht ertragen. Sie sah keine Zukunft mehr. Ich aber habe gesehen, wenn ich hundert Modelle habe und diese hundert Modelle verkaufe, mache ich Gewinn. Wenn du nur einzelne Modelle hast, mußt du eine Galerie haben oder einen Galeristen, der deine Arbeiten verkauft. Aber der haut dich auch wieder übers Ohr. Für ein Bild mit dem Verkaufspreis von viertausend Mark bekommt der Maler schäbige achthundert Mark. Für die achthundert Mark muß er Farbe, Entwurf und vieles mehr einbringen, bis der Galerist das Werk annimmt. Mataré wollte mal einen Vertrag mit einer Pariser Galerie machen, die achtzig Bilder im Jahr haben wollte, von Mataré und auch von mir. Ich konnte noch rechtzeitig aussteigen. 1950 hatte ich den Auftrag, einen Bronzekreuzweg im Kloster der Franziskanerinnen in Königsdorf bei Köln aufzuhängen. Da ich kein Geld für einen Kinderwagen hatte, nahm ich mein Töchterchen Gisela im Waschkorb mit und stellte sie im Klostergarten ins Gebüsch. Während ich ahnungslos in der Kirche auf der Leiter stand, löste das —Moseskörbchenž bei den aufgeschreckten Schwestern große Verwirrung aus, als das Kind sich bemerkbar machte. Die Kinder wuchsen fast in der Werkstatt auf. Als Gisela noch klein war, arbeitete ich an dem großen Taufkessel (1954) für die Kirche in Waldniel. Ich merkte erst nicht, dass sie auf der anderen bereits modellierten Seite des Taufkessels auf ihre Weise das weiche Plastillin bearbeitete. Mit vier Jahren aber half sie mir, die Finger, die Daumen und die Augen für den Schrein von Waldniel zu biegen. Heute hat sie eine eigene Werkstatt mit Laden gegenüber, den ihr Bruder Fidelis, Architekt in Köln, attraktiv gestaltete. DER ATHLET Immer wenn ich etwas Neues gefertigt hatte, verließ ich meine Kellerwerkstatt und zeigte es oben der Frau des Orthopäden. Sie meinte immer: —Nun machen Sie doch nicht solchen Kitsch und moderne Sachen, kein Mensch will das haben, machen Sie lieber Barock.ž Ich versuchte ihr klarzumachen: —Unter modernen Sachen verstehen wir einfache, schlichte Dinge in sachlicher Form, die Aussagekraft haben.ž Zur Hochzeit ihrer Tochter modellierte ich einen Jesus. Sie sagte: —Nein, das wollen wir nicht. In unser Haus kommt so etwas nicht. Da machen Sie so einen dünnen Jesus, ganz verhungert, dem läuft das Blut aus den Wunden heraus, viel zu viel, soviel hat der gar nicht gehabt. Die Herzwunde ist auch auf der falschen Seite!ž Da sagte ich: —Frau Doktor, ich mache Ihnen einen neuen.ž Dann habe ich ihr einen Athleten modelliert. Den nennen wir in der Werkstatt heute noch so, die Abgüsse sind ein Renner geworden. Frau Doktor hat auch den nicht genommen. Ich habe ihr einen von einem anderen Künstler besorgt. 1954, nach drei Jahren Ehe, teilte mir ein Rechtsanwalt in einem Schreiben mit, dass sich meine Frau von mir trennen wolle. Sie trug sich mit dem Gedanken, ihrem erlernten Beruf als Lehrerin nachzugehen und nahm die Stelle als Religionslehrerin bei den Salesianern für dreihundert DM im Monat an. Gerade in dieser Zeit mußten unsere beiden Kinder wegen Tuberkulose ins Krankenhaus nach Wangen. Es war eine schreckliche Zeit. Als die Kinder Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen wurden, war das dritte Kind, Egino, unterwegs, das 1957 zur Welt kam. In Begleitung eines befreundeten Künstlers bat ich den Direktor der Schule um Verständnis meiner Lage, der Anneliese sofort entließ. Sicher, Anneliese kam aus gutsituierten Verhältnissen. Zwei Kinder, die Armut ... Es war eine schreckliche Zeit. In mir brach eine Welt zusammen. Es hat mich aber nicht umgeworfen. Ich war immer Optimist, es drängte mich zu arbeiten, zu entwerfen und Pläne zu machen.  ERÖFFNUNG EINER GALERIE Herbst 1954 Wir haben unsere Kinder in der größten Armut bekommen, die man sich vorstellen kann. Ein Nachbar kam zu mir und meinte: —So kommen Sie nicht weiter. Sie müssen aus dem Keller raus und in einer Galerie ausstellen, sonst bekommen Sie nie Geld.ž Ich erwiderte: —Von 180 bis 240 Mark ist eine Galeriemiete nicht zu bezahlen.ž In meinem Keller stapelten sich die Arbeiten, aber ich konnte nichts verkaufen. Schließlich bot mir der Nachbar seinen leerstehenden Kosmetiksalon an, den ich mit meinen Freunden als Kunstgalerie umgestaltete. Wie sollte ich das je bezahlen können? Mein Nachbar schlug mir vor: —Wenn das Geschäft läuft, zahlen Sie monatlich tausend Mark Miete, und alles ist in Ordnung.ž Sechs Schaufenster wurden voll mit meinen Arbeiten. Mein Atelier in Bonn eröffnete mein Kommilitone Weil, denn gerade an diesem Morgen mußte ich mich bei Gericht zu einem —Friedensgesprächž mit Anneliese einfinden, zu dem sie allerdings nicht erschien. Als ich wiederkam, drückte Manfred Weil mir fünfundzwanzigtausend Mark in die Hand; fast alles war verkauft: Es war nicht zu fassen. Der Eröffnungstag der Galerie in der Kronprinzenstraße 1 war also ein Riesenerfolg. —SANKT MOKKAž 1955 Frage an Egino: B.: —Wo liegt denn Nideggen? Das kenne ich gar nicht.ž E.G.W.: —Bei Düren, eine wunderschöne Burg in einer wunderschönen Gegend bei Monschau in der Eifel. Da in der Nähe ist Kalterherberg, wo ich auch mit der Gestaltung der Kirche beauftragt wurde, eine der ersten großen Arbeiten.ž B.: —Ist da der Pfarrer, der seine Kirche mit geschmuggeltem Kaffee bezahlt hat?ž E.G.W.: —Ja, das wollte ich gerade erzählen. Kalterherberg, genannt ,St. Mokka' liegt unmittelbar an der belgischen Grenze. Der jetzige Pfarrer ermunterte mich, das zu machen, was ich wollte. Herr Johannes, der frühere Pfarrer dieser Gemeinde, war ein Priester am Ende der Welt. Die Jungen hatten keine schulischen Möglichkeiten, sich auf das Abitur vorzubereiten, also gingen sie zum Pfarrer, der den Stoff für das Abitur unterrichtete. Wenn er die Jungens genügend vorbereitet hatte, fuhr er mit ihnen zum Gymnasium nach Aachen, wo sie die Abiturprüfungen ablegten. Der Zug zurück fuhr nur bis Monschau, den Rest mußten sie zu Fuß laufen. Sie kehrten in jede Gastwirtschaft ein, um das Ereignis zu feiern. Jedesmal mussten die neuen Abiturienten den Pfarrer die letzten Kilometer nach Hause tragen. Aber er war ein glücklicher Mann, und zwölf seiner Studenten sind Priester geworden. Die Geschichten um den Herrn Johannes wurden in einem Buch —Der Herr Johannesž festgehalten. Nachdem der zwölfte Priester auf dem Weg von Monschau nach Kalterherberg gefeiert wurde, vergaß der alte Pfarrer in seinem Bett die brennende Zigarette... Das mit den Zwölfen war eine ganz große Leistung, seine Gemeinde bestand nur aus achthundert Seelen. Ich sollte die Sakristeitür aus Kupfer treiben. Es hieß, jeder Bauer stiftet eine Kuh. Ich sollte die ganze Geschichte des Pfarrers mit den zwölf Priestern auf dieser Türe darstellen. Außerdem gestaltete ich noch den Tabernakel und richtete die ganze Kirche ein. Das war die Geschichte von St. Mokka. Alle Bauern haben geschmuggelt, den Kaffee weiterverkauft und damit bezahlt. Alle Türen wünschten sie in Kupfer getrieben. Einen Tabernakel feuervergoldet, ein —riesenž Ding, den Altar aus jugoslawischem Marmor —Kristalinaž. Das war 1955. Einmal hat mir der Architekt den —Mokkawegž gezeigt. Aus der Kirche kommend mußte man drei Schritte gehen, schon war man in Belgien. Das ganze Volk strömte mit Kaffee durch den Kirchgarten.ž B.: —Das war ja bei der Grenzsituation kein Wunder. Und auch in Nideggen hast du Spuren hinterlassen?ž E.G.W.: —Ja. Ich fuhr mit meinem kleinen Hapag-Lloyd-Auto nach Nideggen, wo ich mit der Einrichtung der Kirche beauftragt war. Als ich mit meinen Gesellen dabei war, die kupfernen Türen einzusetzen, zog sich ein Gewitter zusammen. Plötzlich sah ich aus den Haaren, den Händen und dem Werkzeug Blitze leuchten.ž B.: —Hör auf zu übertreiben!ž E.G.W.: —Ich kann dir nur sagen, und jeder Fachmann wird dir das bestätigen, daß es das Elmsfeuer gibt. Die Gesellen waren selber so erstarrt, weil sie bei mir dasselbe Phänomen sahen. Wir befanden uns inmitten der Entladung des Gewitters. Uns aber passierte nichts.ž B.: —Da wärst du ja bald nahe deinen Heiligen gewesen.ž  EINZUG IN KÖLN MIT ATELIER UND WERKSTATT 1956 Zuerst wollte ich in Bonn bleiben, aber der Raum Bonn war für mich wirtschaftlich uninteressant. Ich entschloß mich, mit meiner Werkstatt nach Köln umzuziehen, weil ich mir hier einen besseren Absatz meiner Werke erhoffte. Ich mußte ohnehin jede Woche einmal nach Köln, um Material zu kaufen - Schrauben, Messing, Gold und Silber. Bonn war ja zu der Zeit nur ein —Dorfž und eine Universitätsstadt. Ich hatte mir ausgerechnet, wenn ich jeden Tag einmal hin- und herfahre, wieviel Zeit mir für die Arbeit verloren ginge. Zudem hoffte ich, daß meiner Frau eine Trennung von Bonn guttun würde. In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs sah ich 1954 in den Trümmern ein Schild, dass ein Grundstück zu verkaufen sei. Ein mir bekannter Rechtsanwalt erwarb es für mich. Eine Baracke auf dem Grundstück hätte mir genügt, aber der Architekt sagte: —Nein, wir bauen ein Haus, denn du erhältst auch Zuschüsse.ž Wir bauten also ein Haus in der Marzellenstraße. Ich erhielt natürlich keinen Pfennig Zuschuß. Kurz vor Weihnachten kamen unsere beiden Kinder aus dem Krankenhaus. In der Zwischenzeit hatte ich das Haus erbaut und eine schöne Wohnung eingerichtet für die Familie. Die ersten Monate in Köln waren sehr schwer. Damals blieben mir von 25.000 DM Umsatz nur 3.000 DM übrig. Ich konnte nur niedrige Löhne zahlen. Hier besuchte die Frau des Orthopäden meine neue Werkstatt: —Herr Weinert, das habe ich immer gesagt, Ihre Frau mußte weggehen. Diese arme Frau. Von dem, was Sie verdienen, kann man ja nicht leben. Ich habe immer gesagt, machen Sie Barock.ž —Das kann ich doch nicht, Frau Richartz, ich habe doch schon in der Art, wie ich arbeite, in Rom ausgestellt und viele Aufträge auszuführen.ž Meine künstlerischen Erfolge konnten ihre Ansicht nicht beeinflussen. Nach einiger Zeit der Trennung war Anneliese zurückgekommen. Inzwischen waren zwanzig Leute angestellt, die in drei Schichten arbeiteten und acht Stunden lang Kreuze kratzten. Woran früher sechs Leute eine Woche arbeiteten, das schafft heute einer in drei Stunden. 1960 installierte ich zum Entfernen der Gussrückstände ein gebrauchtes englisches Sandstrahlgebläse für 40.000 DM in meiner Werkstatt, den dazugehörigen großen Kompressor brachte ich aus Platzmangel oben auf dem Flachdach an. Mit Hilfe dieses Apparates können —Gussfahnenž weggestrahlt werden, die vorher per Hand weggekratzt wurden. Kreuze oder halbplastische Bilder von Heiligen, in Handgröße, kleine oder auch große, werden in der Gießerei in Bronze gegossen. Später habe ich es in meiner Werkstatt so eingerichtet, dass jeweils im Wechsel drei Leute Silberteile granulierten, drei bogen, drei emaillierten, drei vergoldeten und polierten und drei machten Schmuck nach meinen vorgefertigten Entwürfen. KREUZE IN ALLE WELT Eines Tages bat mich Pfarrer Graf Geyer von Schweppenburg, damals noch Kaplan am Bonner Münster, Kreuze herzustellen, die in den Wohnungen der Gläubigen aufgehängt werden sollten, da seiner Meinung nach zu wenige Leute Kreuze, also Zeichen des Glaubens, vor allem jetzt nach der Zerstörung der Städte, besäßen. Die Gusskosten bei den Gießern für meine modellierten Kreuze waren überall sehr hoch, sie verlangten pro Kreuz mindestens dreißig Mark. Der Pfarrer meinte, so viel Geld hätte er nicht, um das bezahlen zu können. Ich nahm einen Blasebalg und einen Tiegel und goß die Bronze in der Küche. So konnte ich dem Pfarrer die Kreuze für 3,50 Mark anbieten und hatte selbst noch eine Mark Gewinn. Bald bekam ich einen Auftrag über zehntausend Kreuze, später über weitere zehntausend. Das war meine Grundlage, die es mir ermöglichte, in Wuppertal eine Gießerei zu pachten, in der früher Bahnschilder, wie —Nicht hinauslehnen!ž und —Nicht spucken!ž gegossen worden waren. Bis heute wird dort noch ein Teil meiner Kreuze gegossen. Damals haben wir pro Tag etwa hundert Kreuze geschafft, heute schafft einer in seiner Werkstatt fast tausend Stück. BREGENZ 1966 Viel zu verdanken habe ich dem Kaplan und späteren Pfarrer Holenstein aus Bregenz. Gegenüber dem großen Umspannwerk auf einem einsamen Grundstück entstand mit der Zeit eine Kirche, die ich mitgestaltete: ein Kreuz in der Mitte, seitlich daneben einen mandelförmigen Altar. Er gab mir noch viele interessante Aufträge, mein Leben lang. Ein wunderbarer Mann. Er kümmert sich unermüdlich um Elendsviertel und Notlagen in aller Welt in seiner Funktion als Direktor der Missio in Österreich. IN AMERIKA Durch Empfehlungen wurde ich mit der Einrichtung der Herz-Jesu-Kirche in Los Angeles beauftragt. Zu dieser Zeit mußte man noch den Umweg über Kanada fliegen. Die schnelle Wetterumstellung machte mir dabei jedesmal sehr zu schaffen; denn trotz Operationen und Eingriffen war man auch in Bonn meiner Stirnhöhlenvereiterungen nicht Herr geworden. Einmal brachte man mich von San Francisco aus zu einer Pfirsichplantage, wo in ihrer Mitte gerade die Grundmauern für die neue Kirche San Clemente erstellt worden waren. In vierzehn Tagen stand die Kirche. Den Teppich und die Errichtung einer Wand aus Ziegeln konnte ich selber bestimmen. Einen Monat lang arbeiteten wir in Köln an den Fenstern. Die Kosten waren auf zwanzigtausend Mark veranschlagt. Wir transportierten die Fenster nach Amerika, durften sie aber selber nicht einsetzen, denn sonst hätten die amerikanischen Arbeiter sie aus Eifersucht zerschlagen. Nur für das Aufstellen nahmen die Glaser - eine Arbeit von zwei Tagen - zwanzigtausend Dollar. Wir hatten sogar angeboten, es umsonst zu machen. Ein Pfarrer empfahl mich dem nächsten, denn auf diesem Wege sparten die Pfarreien viel Geld, anstatt den Umweg über die Vermittlung in New York zu nehmen. Der Heißhunger nach religiöser Kunst kam mir zugute. Nahe der kanadischen Grenze ergab sich durch die Vermittlung eines Paters die Gelegenheit, eine Ausstellung in einem Eurikahotel an einem —Thanksgiving Dayž zu eröffnen. An einem Tag konnte ich alles verkaufen und verdiente 60.000 Dollar. Mein großer Jubel wurde gedämpft, als der Pater sagte, dass die Hälfte ihm zustände. Mir wurde angeraten, die Emaillebilder nicht höher als 800 Dollar zu verkaufen. Das war nicht viel bei dem hohen Kostenaufwand. Aber dennoch brachte es einen Gewinn durch den zu dieser Zeit günstigen Dollarkurs. In Minnesota fuhren wir durch große Wälder, wo man oben auf riesigen Baumstümpfen, fünf oder sechs Meter über der Erde Häuser aus Holz für Frauen- und Männerorden errichtet hatte. Ich war mit der Einrichtung einer Kapelle beauftragt, die im Fertighausstil erbaut worden war. Die Objekte, die ich im Container von Köln nach Amerika versandte, passierten im Schiff den Panamakanal. Die deutsche Versicherung übernahm die Verantwortung für die Fracht nur bis zur Küste wegen der damaligen Unsicherheit. Während der Passage durch den Kanal mußte dreimal nachversichert werden. Fast zweimal im Monat flog ich von Köln nach Amerika. Wegen meiner Unkenntnis der englischen Sprache war ich immer auf fremde Hilfe angewiesen. Ein Deutschamerikaner, der in Köln ein Kirchenbedarfsgeschäft geführt hatte, bot mir seine Hilfe an und reiste mit mir durch Amerika. Er war zuvor auch eine Zeitlang Kellner in Las Vegas gewesen. Mit seiner Hilfe eröffnete ich in San Francisco unter der Golden Gate Bridge in der Batterystreet einen Laden auf seinen Namen und den seiner französischen Frau. Es war eine günstige Lage, zentral gelegen, vom Freihafen nicht weit entfernt. Der Laden wurde über ein Jahr lang eine große Touristenattraktion. Als ich wieder einmal den ganzen Lagerbestand mit Kelchen, Monstranzen, Tabernakeln und vielen anderen Dingen fertig zum Transport für eine geplante Ausstellung gepackt hatte, brannte über Nacht der Manager mit seiner Frau durch mit all meinen Werken und der Kasse. WIEDER ZURÜCK Drei Tage lang war ich verzweifelt. Als Deutscher konnte ich aber im Ausland schlecht einen Prozeß nach amerikanischem Recht führen, und so schrieb ich die Galerie ab. Pfarrer Graf Geyer von Schweppenburg bot mir zu diesem Zeitpunkt seine Burg, in der Eifel vor Maria Laach gelegen, zum Kauf an. Ich nahm sie zur Miete für tausend Mark im Jahr. Ich hatte es übernommen, sie zu restaurieren, denn sie war zuvor ein Bordell gewesen. Die Burg beherbergte eine große Bibliothek und hatte keine Heizung. In den Türmen hausten die Eulen, auf den alten Stühlen meine Kinder. Die Federkerne guckten aus den barockgeschwungenen Stühlen, als eine alte Dame der Familie zur Inspektion erschien. Inzwischen hatte ich die Bauleitung der Krankenhauskapelle in Brohl durchgeführt, alles selber gemacht: die Decke, die Fenster, den Boden, das Weihwasserbecken, die Betonverglasung, den Tabernakel, das Hängekreuz, den Kreuzweg, die Bänke ... Die Generaloberin der Waldbreitbacher Schwestern, Mutter Edmunde, hatte mir viele Aufträge besorgt. Ich hatte die Einrichtung der Kapelle des Krankenhauses Neuwied übernommen, den Kindergarten und die Kirche Maria Himmelfahrt zusammen mit Professor Böhr aus Koblenz. Die Burg mußte ich jetzt verlassen. Ein finanzstarker Käufer hatte viel geboten. Auch Adenauer kam noch einmal in meine Werkstatt und gab mir den Auftrag, eine Kirche für 120.000 Mark umzubauen. Durch diesen Auftrag erhielt ich später noch viele andere. Adenauers Auftrag fiel genau in die Zeit, als man mir meinen linken Arm, mit dem ich meine Arbeiten ausführe, abnehmen wollte. Er schmerzte seit langem. In der Universitätsklinik sagte man mir, ich hätte Krebs. Man spritzte mir ein neues Mittel, mit dem man hoffte, den Eingriff verhindern zu können. Auf dem Heimweg vor der Haustür brach ich zusammen. Anneliese mußte mich ins Haus schleppen. Sie rief meinen Bruder Peter, einen Kinderarzt, der sich mächtig darüber aufregte, dass man mir ein nicht erprobtes Mittel gespritzt hatte. Ein befreundeter Chirurg nahm mich in seine Klinik auf, weil er meinte, dass es besser sei, noch weiter zu untersuchen, als mich gleich der Amputation auszuliefern. Er öffnete meinen Arm und stellte fest, daß sich nur ein Stück Knochen zurückgebildet hatte und der Arm nicht von Krebs befallen war. Er setzte ein Stück Kunststoff ein und rettete so den Arm mit meiner einzigen Hand. —LITURGIE IST EIN TANZEN UM GOTTž (PICASSO) 1965 tagte in dem Kloster Montserrat bei Barcelona der Liturgiekongreß, verbunden mit einer Ausstellung Christlicher Kunst. Es fand eine Diskussion über Liturgie statt. Für mich war es ein Problem, dass ich kein Französisch verstand. Ein Kapuzinerpater aus dem Elsaß übersetzte für uns ins Deutsche, aber nur das, was er für angebracht hielt. Die frechen Bonmots von Picasso wurden gesiebt. Einer fragte Picasso, was er von Liturgie hielte. Er antwortete, er hätte schon ein Bild dazu gemalt. Auf dem Bild ist eine Taube und um die Taube tanzen Figuren. Dazu sagte er: —Liturgie ist ein Tanzen um Gott.ž Der Professor erwiderte: —Naja, Sie sind ja ein Ungläubiger, mit Ihnen kann man über Liturgie nicht reden.ž Ich fand, Picasso hat das Schönste von der ganzen Tagung gesagt. Anschließend schenkte er das Bild dem Abt des Klosters, der es mir weitergab. Picasso war ein neugieriger Mann. Aber ich erinnere mich an seine Aussprüche, die wirklich wahr sind, jedenfalls nehme ich an, daß sie wahr sind, daß er bewußt die Leute veräppelt hat. —Die Menschen wollen veräppelt werden, also veräppeln wir sie.ž Das Verhalten des dolmetschenden Paters brachte mich auf die Idee, für solche internatonalen Veranstaltungen eine Simultananlage von Siemens zu erstehen. Sie kostete mich damals 40.000 DM. Ein Wahnsinnsgeld! Am Ende hat es mich aber nichts gekostet. Ich habe sie verliehen, zweimal sogar für 10.000 DM dem Bundestag, der damals so etwas noch nicht hatte, einmal dem Minister Blüm, als er sich in seiner Anfangszeit profilierte. Die Anlage wurde vor allem bei den Liturgiekongressen eingesetzt. Jetzt liegt sie vergessen auf dem Speicher, von der Zeit überholt. WERKE MODERNISIEREN Georg Meistermann hat in Köln in St. Kolumba - —St. Maria in den Trümmernž - ein Glasbild der heiligen Cäcilia erstellt. Eines Tages komme ich in die Kirche und denke, das ist doch das Bild vom Meistermann. Da hatte er aber inzwischen das Bild so verändert und —modernisiertž, daß es nicht mehr das ursprüngliche Bild war. Mit Meistermann arbeitete ich 1958 gleichzeitig an der Inneneinrichtung der neugebauten Michaelskirche in Solingen. Er gestaltete das große Fenster, das die Dreifaltigkeit darstellt, seitlich vor dem Altarraum. Er, der Sohn eines angesehenen Schuhmachers in Solingen, war eine zeitlang Zeichenlehrer an dem dortigen Gymnasium. Ähnliches hab ich mit Mataré in Kripp, das liegt bei Remagen am Rhein, erlebt. Ich entdeckte in der Kirche eine Pietà, zwei mal zwei Meter groß, und beim genauen Hinsehen ein kleines Schild darunter: Mataré. Als Ewald wieder zu mir ins Atelier kam - ich arbeitete für ihn - erzählte ich ihm von meiner Entdeckung. —Ach, steht die noch?ž meinte er. —Ja, die existiert noch.ž Als junger Mann war er in Kripp nach dem Krieg mit seiner Freundin untergekommmen. Der Pfarrer hatte ihn in der knappen Zeit mit Essen versorgt. Als Dank dafür erhielt der Pfarrer damals diese Pietà - noch im Nazarener Stil. Als ich nach Monaten wieder nach Kripp fuhr, um die reparierte Monstranz abzuliefern, schaute ich mir die Pietà noch einmal an und dachte, ich werde verrückt. Es guckten nur noch ein Arm, ein Kopf und ein paar Beine aus der Wand raus. Alles andere war weggehauen. Es sah aus wie nach einem Bombenangriff. Der Pfarrer meinte, Mataré sei dagewesen, habe an der Figur gearbeitet und wolle daran weiterarbeiten. Als Mataré wieder zu mir kam - wir waren mit den Türen des Rathauses in Aachen beschäftigt - fragte ich, was in Kripp passiert sei. Er sagte: —Weißt du, ich hab das Ding gesehen. Eine ganz frühe Arbeit von mir. Ich bin dahin gefahren und habe sie geändert. Die Dinge, die gut waren, habe ich belassen, die anderen weggehauen. Der Pfarrer hat nichts gesagt. Er wartet, dass ich weiter daran arbeite. Für mich ist die Sache erledigt.ž Ich finde, man muß zu den —Sünden seiner Jugendž stehen. Sie waren einmal ehrlich gemeint. Das hab ich ihm auch gesagt. Mataré war ein vornehmer Mann, hatte aber nie Geld. Als er einen Brunnen überdimensional geschaffen hatte, zahlte das Generalvikariat nicht. Er suchte Kardinal Frings auf, der meinte: —Sie sind doch so ein reicher Mann. Brauchen Sie noch Geld?ž Ich arbeitete zwei oder drei Monate für Mataré. Er konnte nicht zahlen, dafür habe ich aber enorm viel von ihm gelernt. Die Domtüre mit dem Thema —Brennendes Kölnž konnte er nicht transportieren. Ich half ihm. Öfter meinte er: —Sollen wir nicht runter in den Keller gehen, denn die Pfarrer zahlen meine Sachen manchmal mit Wein.ž Der Schöpfer fordert auch, die größte Qualität zu bringen, sonst würde ich mich nicht anstrengen. Unsere Sprache ist so einmalig, jeder Mensch drückt sich auf seine Art aus, malt einmalig, schreibt einmalig. Ich glaube, wenn ich Wissenschaftler wäre, würde ich die Sprache untersuchen. Aber ich habe Angst, daß ich immer wieder das gleiche —Vaterunserž, —Gegrüßet-seist-Du-Mariaž und das Glaubensbekenntnis so heruntersage, obwohl ich versuche, es einigermaßen gut zu beten. Aber es wäre schöner, es mit eigenen Worten zu sagen. Wir finden in der Welt nicht viele gläubige Menschen, die mit uns eins sind. Ich fühle mich sehr einsam in der Welt. Jeder kann mitwirken, handeln oder schreiben aus den Problemen der heutigen Zeit, wie ich das mit den Heiligen mache. Es wird von Heiligen gesprochen, aber nicht von ihrer Not, ihren Versuchungen. Man traut sich nicht zu sagen, dass der Teufel versucht, jeden Menschen aufs Glatteis zu führen. Das ist die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Jesus sagt: —Ihr werdet gesiebt werden, wie man Weizen siebt.ž Das sollten wir nicht übersehen. Wenn es keine Krankheiten gäbe, würden wir nicht wissen, dass wir gesund sind. Wenn wir keine Not hätten, wüßten wir nicht, dass es Glück gibt. B.: —Das sind Sätze, die du hier behauptest, die man nicht ungeprüft hinnehmen kann.ž E.G.W.: —Ich meine doch, ich habe mir das gut überlegt.ž B.: —Wenn es keine Not gäbe, wüßten wir nicht, was Glück ist ...ž E.G.W.: —Wenn Adam nicht gesündigt hätte, würde es keinen Tod geben.ž B.: —Du monierst, dass die Kirche die Schattenseiten nicht aufzeigt.ž E.G.W.: —Und dass wir damit fertig werden müssen.ž B.: —Die Mängel in der Darlegung der christlichen Lehre nehmen die jungen Leute heute zum Anlaß, sich überhaupt nicht mehr damit zu befassen, sondern das Ganze zur Seite zu schieben. Das wird vielleicht kommen, wenn sie älter und in Not sind.ž E.G.W.: —Wir sind so erzogen worden: Achte deine Eltern oder deine Erzieher, bete für sie, denn sie sind diejenigen, die dir das Leben ermöglichen. Ich werfe unserem Pfarrer vor, daß es ihm nicht gelungen ist, meine Kinder, die ich sonntags alle zur Messe mitnahm, so zu fesseln oder zu überzeugen, daß sie sich nicht mit dreizehn, vierzehn Jahren von der Kirche entfernten.ž B.: —Und die Eltern?ž TÜRE ALS KARIKATUR In Köln ist es Sitte, daß sich die Stadtväter karnevalistische Späße erlauben und auch welche ertragen müssen. 1959, in der Aufbauphase des zerstörten Köln, hatten die Bauherren Hans und Erich Lappe ein Haus gegenüber der —Schwarzen Madonnaž gebaut. Zuvor hatten sie von der Stadtverwaltung die notwendige Genehmigung erhalten. Als das Haus im Bau war, fiel Frau Dr. Charlotte Adenauer, die als Landeskonservatorin tätig war, ein, dass das Haus gegenüber der Kirche —Schwarze Madonnaž doch viel zu hoch sei. Sie bestand darauf, dass eine Etage wieder abgerissen werden müßte. Lappe sagte natürlich höchst verärgert: —Kommt überhaupt nicht in Frage, was einmal gebaut und genehmigt ist, bleibt bestehen. Das kann kein Mensch rückgängig machen.ž Der Architekt Hans Schilling aber riß —nachtsž die Anfänge der Etage —eigenhändigž wieder ab. Bauherr Lappe kam daraufhin zornig und verstimmt zu mir und gab mir seine Haustüre in Auftrag. Ich sollte die Stadtväter so richtig auf den Arm nehmen. Die kupfergetriebene Türe fand er künstlerisch hervorragend. Er bezahlte auch im voraus dafür. —Zirkusž hieß das Thema. Das —Bauverhinderungsamtž mußte aufs Korn genommen werden. Im Bart ist das Wort noch heute als Schrift zu lesen. Die Baubehörde arbeitete zu langsam, so dass nicht alle bauen konnten, die bauen wollten. Vor dem Türgriff liegt ein Besen, der goldene Besen. Jeder wußte, wen der darstellen sollte: die Sekretärin vom Oberbaurat Löwe, die keinen an ihn heranließ. Sie selbst prüfte die Anträge, und wenn ihr etwas nicht passte, war der Herr Oberbaurat halt nicht da. Deshalb brachte ich noch eine Schaufel zum Besen an. Auf der Einladung zum Zirkus ist zu lesen: —Kraftakt, Architekt arbeitet nur mit Netz.ž Den Bauherrn Lappe modellierte ich als Stier, der gegen die Paragraphen anging, die in Emaille und Silber gestaltet und vergoldet sind. Unten sind die Bauleute dargestellt, die von allen möglichen Behörden schikaniert werden. Nachts gingen die so Veräppelten mit aufblitzenden Feuerzeugen heimlich nachsehen, was alles auf der Türe abgebildet worden war. Ein Prozeß wurde angestrengt. Fotografen und Reporter wurden nicht zugelassen. Nichts durfte an die Öffentlichkeit. Nach der angestrengten Gerichtsverhandlung vertrug man sich nach kölnisch-menschlicher Art wieder und der friedliche Ausgang wurde gemeinsam im Gasthaus —Zur letzten Instanzž gebührend gefeiert. WERKSTATT IN DENIA (SPANIEN) Immer wieder plagten mich, wie schon im Kloster, furchtbare Stirnhöhlenvereiterungen. Im Marienkrankenhaus auf dem Venusberg in Bonn war ich operiert worden. Ein Professor der Uni-Klinik, den ich aufsuchte, riet mir zur Genesung meiner Stirnhöhlen zu einem Spanienaufenthalt. Ella Brosch besorgte mir ein Zimmer inmitten der Stadt Denia. Vier Wochen allein am Strand, der Eiter begann aus dem Kopf zu fließen. Das Baden im Salzwasser hatte eine ungeheuer heilende Wirkung. Zurück in Bonn, riet mir der Arzt, meine Familie, die sich inzwischen um zwei Jungens vermehrt hatte, einzupacken zu einer Nachkur. Zuerst bezog ich ein kleines Haus in Las Rotas, in dem länger zu wohnen Anneliese ablehnte. Um mich jedes Jahr während der Sommermonate in Spanien ausheilen zu können, ließ ich in Denia preisgünstig ein Haus bauen und gründete da 1963 ein Atelier, eine kleine Gießerei, eine Gravier- und Emaillierwerkstatt. Das Zentrum der Majolikaverarbeitung (Ton) liegt in der Nähe in Manesis. Hier ließ ich Majoliken anfertigen von meinen Madonnen und Kreuzen. Meine Kinder bekochte ich oft selber, und wir lebten bescheiden. Manchmal fuhr ich über Land. Da gab es in Gasthäusern große Portionen zu kleinen Preisen. Hier in Denia entstanden die meisten meiner Kreuze und die handgroßen Heiligenreliefs. Das Haus war das erste an dem Berg. Unter mir dehnten sich große Weingärten, die die Reblaus über Nacht befiel und vernichtete. Sie wurden durch Orangenhaine ersetzt. Die Löcher für die Bäume mußten in den felsigen Boden eingebracht werden. Als unten im Tal gesprengt wurde, flogen die Steine bis nach oben und große Schlangen kamen auf unseren Berg. Solche Schlangen hatte ich noch nie gesehen. Sie wurden aus ihrem Lebensraum unten vertrieben. Die Schlange, die einmal bis zu unserem Haus gekommen ist, kam mit einem Schuß über die Mauer. Sie wurde immer länger. Dann verschwand sie im Garten in einem Loch. Vor lauter Angst kippte ich Salpetersäure hinterher und passe seitdem immer auf, wenn ich die Treppe runter gehe. Im Laufe der Jahre wurde der Orangenhain immer kleiner und durch Einfamilienhäuser ersetzt, denn der Blick von hier oben auf das Meer und die Altstadt mit der Burg ist einzigartig. Um mich herum entwickelte sich eine kleine Künstlersiedlung. Gleich hinter mir baute Professor Mustielles, Bildhauer und Direktor der Kunstakademie in Madrid. Nebenan ließ sich ein Maler nieder, der beeindruckende meditative kleine Bilder macht, sich aber inzwischen in ein Haus neben einem Klarissinnenkloster vor Madrid zurückgezogen hat. Aber Anneliese gefiel es auch hier nicht. Die Einsamkeit, die Mücken und die Hitze fand sie unakzeptabel. Sie leitete lieber in Köln den Laden und das Atelier und genoß den Freiraum. Jeden Tag nahm ich mir die Zeit, Anneliese einen langen Brief zu schreiben. Als ich meinen Eltern gegenüber von mir ein kleines Haus beschaffte, waren die Kinder gut versorgt. Meist modellierte ich am Meer, die Kinder um mich herum. Die Ideen, die Kreuze mit halbplastischen Bildern anzureichern, flogen mir zu. Zu fliegen war zu der Zeit noch zu teuer und die Verbindungen von Deutschland nach Spanien umständlich. Alle zwei, drei Monate fuhr ich von Köln aus nach Denia, die Arbeit für die angestellten Leute, die ich vorübergehend mit nach Köln genommen und in bestimmten Arbeitsbereichen ausgebildet hatte, einzuteilen und abzuholen. Einmal flog ich mit meinen Kindern in Begleitung von Pater Nicolaus nach Valencia mit einer zweimotorigen Maschine, in der damals nur vier bis zehn Personen Platz hatten. Wir kamen in ein Gewitter und sackten so schnell ab, dass Tassen durch das Flugzeug flogen und wir unter der Decke hingen. Der Pater fing sofort an zu beten, anstatt meine Kinder festzuhalten. Alle schrien im Flugzeug, und alles Geschirr, das ich im hinteren Teil des Flugzeugs auf einer Anrichte gesehen hatte, stand regelrecht in der Luft. Wir landeten aber trotzdem glücklich in Valencia. Alle stiegen aus. Gelb wie Chinesen. Die Kinder flogen alleine nach Deutschland, Pater Nicolaus und ich aber zurück nach Alicante und von dort mit dem Auto nach Denia. Es war abgemacht, daß Anneliese die Kinder am Flughafen in Köln abholt. Als ich in Denia eintraf, lag dort ein Telegramm: —Kinder sind nicht angekommen.ž Ich fuhr sofort zum Flughafen und fragte bei der Iberia nach. Doch die konnten mir nur versichern, dass die Kinder abgeflogen seien. Ich rief in Köln an, doch auch da sagte man mir, sie hätten Mitteilung von Valencia, die Kinder seien abgeflogen. Ich solle nach Barcelona fliegen und da nach den Kindern forschen, denn da hätten sie umsteigen müssen. Ich flog nach Barcelona, wo ich keine Auskunft bekam, weil Feiertag war. Man riet mir, mich an die Deutsche Botschaft zu wenden. Ich wetzte also zur Deutschen Botschaft, wo es hieß: —Ja, die Kinder sind hierž. Ich fragte sofort. —Was ist denn los?ž Genau an dem Tag war der Pass der Kinder abgelaufen. Sie müßten zuerst einen neuen Pass haben, um weiterfliegen zu können. Die Kinder habe man mit etwas Geld und einer Betreuerin auf den Markt geschickt. Nach längerem Suchen fand ich sie schließlich auch. Sie schrien: —Papa, Papa, wir haben einen lebendigen Affen.ž Es flossen Tränen, als sie sich von ihm trennen mußten. Sie wollten ihn tatsächlich mit nach Deutschland schleppen. Von Deutschland aus mussten meine Angaben überprüft werden, erst dann wurde ein Ersatzpass ausgestellt. Am nächsten Tag brachte ich die Kinder wieder zum Flug nach Köln. Ich hatte kein Geld mehr in der Tasche und mein Auto stand noch in Valencia. Hier, in Denia, besuchten mich viele Freunde und auch Geistliche, die mir und den staunenden Anwohnern Gelegenheit boten, in der nahegelegenen kleinen Kapelle ihre Messe auf dem Berg in San Juan zu besuchen, denn die nächste Kirche ist St. Antonius in der Mitte der Stadt. Für mein damals frei hängend geschaffenes, drei mal vier Meter großes Kreuz mit Emailbildern in dieser Kirche, für das hat sich Frau Brosch wesentlich eingesetzt. Durch Bischof Schick aus Fulda, der mir auch vorlas beim Modellieren, erfuhr ich Wesentliches über die Dreifaltigkeit. Eines Tages kam Oscar Neisinger zu Besuch, der Julis Döpfner, den Bischof von Würzburg gut kannte. Er übermittelte mir den Auftrag für eine Madonna. Nun hatte ich hier in Spanien kein greifbares Material. Die Madonna sollte ganz in Gold sein. Da nahm ich als Untergrund für die Madonna einen Bocksbeutel und modellierte darüber. Sie steht jetzt in Dachau mit einem Osterleuchter. Als junger Mann, ich war etwa achtzehn, hörte ich Oscar zum ersten Mal auf einem Jugendtreffen, wo er in gleißender Sonne nicht müde wurde, mit seiner zweieinhalbstündigen Rede zu beeindrucken. —Wer seine Knie nicht vor Gott beugt, wird es vor den Götzen tun!ž Ich konnte das Stehen nicht mehr aushalten. Aber er hat geredet. Ich konnte nicht verstehen, wie so ein junger Mensch, kaum älter als ich, so lange reden konnte und mit solcher Intelligenz. Er hat einmal im —Konradsblattž eine riesige Beilage - vier Seiten - über meine Arbeiten publiziert. Das ging durch die Weltpresse. Aber die größte Rückendeckung erfuhr ich durch Erzbischof Heim, den späteren Nuntius. Ich habe früher immer nur gestaunt, woher Oscar sein Geld hatte. Und wenn er zu mir kam, war seine erste Frage: —Wie machst du es, daß du so berühmt bist?ž Oder er kam: —Egino, kannst du mir mal 1000 DM pumpen, ich muss mal schnell nach Amerika.ž Er war einfach weg und besorgte sich einen Posten bei der Auslandseelsorge. Jahre später, als seine Frau an einem Hirntumor starb, beauftragte er mich mit der Gestaltung des Grabes auf dem Friedhof in Würzburg. AUFTRÄGE IM AUSLAND Durch die Vermittlung von Erbischof Heim erhielt ich in Kairo, auf Grönland, in Schweden, Norwegen und Finnland, Dänemark und Island Aufträge, Kirchen oder Kapellen einzurichten. Der Nuntius, äußerst gewandt in vielen (12) Sprachen, nahm mich mit auf den Fahrten über das Europäische Nordmeer. Auf Island gibt es kaum Pflanzen, die Isländer lieben Farben - ein buntes Fenster ist schon eine Pracht. Ein Streik der Schiffsleute verhinderte meine Rückfahrt nach der Einrichtung der Karmeliterinnenkirche und ermöglichte mir, bewaffnet mit Stift und Pinsel, ein mehrwöchiges Erkunden der Insel. In den vier Wochen malte ich eine Reihe Bilder. Island, ein wunderschönes Land mit herrlichen Tälern und Hügeln, aber ohne Bäume, in den Gletschern die Vulkane - Feuer im Eis. In Finnland richtete ich zwei Kirchen ein, davon eine mit Erzbischof Heim und durch seine Initiative über dreißig Kirchen in Skandinavien. NUNTIUS HEIM Mitten in einem Reitpark des englischen Hofes außerhalb von London, befindet sich die Nuntiatur. Bei einem Diplomatenempfang in der Nuntiatur durfte ich als Gast dabeisein. Auch die Königinmutter war zu Gast. Ich war bei ihr zu Tisch geladen, konnte aber kein Wort Englisch und sollte ihr als Künstler meine Werke vorstellen. Auch Agatha Christie war da. Sie bestellte eine Pillendose für ihren Mann. Auf der Dose sollte ein Greif modelliert sein, ihr persönliches Zeichen. Sie erklärte mir immer wieder, wie die Pillendose beschaffen sein sollte, aber es mußte mir alles übersetzt werden. Erzbischof Heim, Vorsitzender des heraldischen Clubs in London, brachte in einem seiner Heraldikbücher auch eine Abbildung von seinem St. Gimo-Schrein, den ich für ihn mit Themen aus dem Alten Testament, zum Beispiel David mit seinem Speer vor König Saul und Wappen von Leuten, die ihm begegnet waren, in feinstem Silber angefertigt hatte. Erzbischof Heim wurde Apostolischer Delegierter von Skandinavien (1961-69) und ab 1966 dazu noch Nuntius von Finnland und später von Ägypten (1969-1973) und Großbritannien. Er beauftragte mich, seine Kapellen in den Nuntiaturen einzurichten, ebenso bei der Übernahme der Nuntiatur in Dänemark und England. Er nahm übrigens immer seinen Stamm von Schwestern mit, um sich in den verschiedenen Sprachen der Nonnen fit zu halten. Der Erzbischof wußte, daß ich so gerne esse. Er lud mich ein zum Pilze suchen in Gesellschaft des Kronprinzen von Dänemark. Der Sekretär des Erzbischofs, ein Italiener, sagte mir: —Herr Weinert, man läßt zuerst seine Exzellenz die Pilze finden.ž Das war für mich natürlich peinlich. Ich hatte so viele Pilze gefunden und der Erzbischof nur wenige. Wir fuhren zurück ins Palais nach Kopenhagen, ein wunderschönes Haus am Meer mit eigenem Strand, wo der Nuntius selbst die Pilze zubereitete. Ich erinnere mich an einen hervorragenden Cocktail, nach dessen Genuss ich nur noch auf Zehenspitzen tanzte. Die Nuntiatur in London ist voll ausgestattet mit meinen Sachen. Für eine Nische in der Londoner Kapelle gab der Nuntius eine ein Meter hohe Madonna in Auftrag. Die erste Madonna war zu groß, die zweite, diesmal in Bronze, erregte auch nicht das Gefallen des Erzbischofs. Er wünschte sich doch mehr eine Madonna in Emaille, ähnlich der, die ich für ihn in Kairo gemacht hatte. Ich brachte die Madonna nach London und fragte, ob ich meine andere Madonna nicht zurückbekommen könnte. Doch die wollte er auch behalten. Ich hörte lange nichts mehr von ihm. Auf einmal erfuhr ich in Köln aus einem Brief, dass der Sekretär von Papst Paul VI. beim Nuntius die Madonna gesehen hatte. Sie gefiel ihm so gut, dass ich noch eine zweite arbeiten mußte. Aus dieser Zeit stammt auch die Bekanntschaft mit dem Grafen Henckel von Donnersmarck, dessen Bruder auch Priester wurde. Ich machte für ihn unter anderen einen sehr kostbaren Kelch und eine Patene. Er gehört dem Orden der Prämonstatenser Chorherren an, ist bescheiden und souverän. Er kaufte viele Rosenkränze. In Duisburg war die Priesterweihe. Die große Welt war da. Ich lernte auch Kardinal Tisserant aus Paris kennen. KONTAKTE MIT DEM VATIKAN Im Frühjahr 1969 überraschte mich ein Telegramm, ich sollte nach Rom kommen, der Heilige Vater wünsche von mir einen Kelch. Meine Frau traute der Sache nicht: —Da ist ein Prälat, der billig an einen Kelch kommen will. Da fährst du nicht hin.ž Vorsichtshalber packte ich meinen Koffer auch mit ein paar Kreuzen, Kelchen und meinen Katalogen voll; oben drauf legte ich meinen guten Anzug und wartete ab. Vierzehn Tage später erreichte mich ein zweites Telegramm, ich sollte mich an der bronzenen Pforte des Vatikans melden. Ich fuhr sofort zum Flughafen. Nachts um ein Uhr kam ich in Rom an. Ich erkannte die Stadt, die ich zuletzt als Soldat gesehen hatte, nicht mehr wieder. Ich schlief auf einer Bank und stand früh morgens an der bronzenen Pforte des Vatikans. Zwei Schweizer Gardisten lachten mich aus, als ich ihnen das Telegramm zeigte. Ein anderer Gardist kam winkend auf mich zu: —Kommen Sie mal rein.ž Wir durchquerten einen wundervoll ausgemalten Raum. Ich wäre am liebsten stehen geblieben, um zu schauen. Nach mehreren Stationen kam ich in einem kleinen Raum an, wo wir warten mussten. Ich dachte: —Gleich geht die Türe auf und eine große Gestalt kommt herein.ž Die Türe ging auf und eine ganz kleine Gestalt erschien: Papst Paul VI. Ich kniete nieder. —Na, was haben Sie denn Schönes mitgebracht?ž Zuerst habe ich mich entschuldigt: —Ich bin im ,Arbeitsanzug' hier, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich wirklich zu Ihnen kommen soll.ž Ich machte meinen Koffer auf, und er lachte, als er meinen Anzug sah. Meine Kelche holte ich hervor, zuletzt einen Becherkelch: —Das ist ja ein Becher, wie sind Sie denn darauf gekommen?ž Ich sagte ihm: —In der Heiligen Schrift steht doch: ,Den Becher des Heils will ich ergreifen und anrufen den Namen des Herrn'ž. —Endlich mal ein Theologe. Wo haben Sie das denn her?ž Ich erzählte ihm, dass ich fünfzehn Jahre Bruder bei den Benediktinern gewesen war. —Das ist aber schön zu erfahren. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht, einen Künstler mit Theologiekenntnissen kennenzulernen. Ich wünschte mir, wir hätten eine Schule, an der Künstler Theologie studieren können.ž Ich sagte: —Der Kelch entspricht nicht den Vorschriften. Er wird deshalb in Köln nicht geweiht, den nehme ich wieder mit.ž —Nein, wenn der Heilige Vater den benutzt, ist er geweiht.ž Ich hatte mich immer wieder bei Geistlichen um die Weihe des Becherkelches bemüht. Der Papst aber hat alles genommen, was ich mitgebracht hatte. Er beauftragte mich, ihn zu porträtieren und eine Münze von ihm herzustellen. In kürzester Zeit wurden Zeichenpapier und Kohle gebracht. Nach zwei Stunden kam der Sekretär: —Jetzt müssen Sie aufhören. Wenn Sie noch eine Sitzung brauchen, kommen Sie morgen wieder.ž Am nächsten Tag saß der Papst im Saal des heiligen Clemens auf dem Thron. Daneben standen zwei Assistenzsitze, einen davon wiesen sie mir zu. Im Saal waren Kardinäle und Bischöfe versammelt. Es war schwer, den Papst zu malen, da er bei seiner anschließenden Rede immer hin und her ging. Beim Abschied fragte mich der Papst, was ich denn noch in Köln an Kunstwerken hätte. Ich erzählte, dass ich gerade ein Kreuz von vier Metern Höhe in Arbeit hätte. Am liebsten würde ich ihm einen ovalen Altar mitbringen - oval, damit die Gläubigen sich mehr einbezogen fühlten. Er aber lehnte ab. Einen anderen Altar, Tabernakel und anderes mehr sollte ich aber bei meinem nächsten Besuch mitbringen. Auf meine Frage nach dem Zoll wurde mir ein Diplomatenausweis versprochen. Im Herbst erreichte mich die Bitte, Weihnachten mit all den gewünschten Kunstgegenständen wieder zum Vatikan zu kommen. Mit dem Diplomatenpass waren die Grenzen kein Problem. Ich sollte meine Sachen in der Fiora, einem Gartenhaus im vatikanischen Garten, abladen. In der Fiora befanden sich die Präsente, die der Papst geschenkt bekommen hatte. Es regnete in Strömen. Plötzlich kam uns, meinem Sohn Fidelis, dem Gesellen und mir, eine schwarze Gestalt entgegen, die einen Regenschirm hielt, damit eine andere schwarz gekleidete Person nicht nass wurde. Wir gingen auf die beiden zu und merkten, daß die eine der Heilige Vater war. Wir knieten uns natürlich sofort hin und zwar in den dicksten Matsch, um den Segen zu erhalten und suchten zusammen die Fiora auf. Dort kniete sich der Papst auf den Fußboden und freute sich wie ein kleiner Junge über meine ausgebreiteten Sachen. —Ich nehme alles, bis auf die viereckige Altarplatte. Dafür möchte ich eine ganz große ovale Platte haben, damit alle Menschen daran Platz haben.ž Der Altar, den ich später nachlieferte, wurde in der ungarischen Botschaft aufgestellt. Jede Botschaft hat nämlich ihre eigene Kapelle. Meinen jüngsten Sohn Fidelis fragte der Papst, ob ihm die Schmuckkünstler auf der Spanischen Treppe gefallen hätten, worauf der Junge sagte: —Nö, das biege ich aber auch.ž Zum fünfzigsten Priesterjubiläum haben wir eine Gedenkmünze des Papstes herausgebracht; sie ist aber nicht so gut —angekommenž. Ich glaube, dass dem Heiligen Vater die Münze nicht besonders gefallen hat. Auf der Rückseite habe ich einen Kelch abgebildet mit vielen Köpfen, die die Menschheit darstellen sollten. Der Sekretär sagte mir später, der Heilige Vater würde das Imposante nicht so sehr lieben. Er bevorzuge das Schlichte und Bescheidene. Ein besonderer Auftrag war der Entwurf eines Gebetbuches. Als ich es später im Vatikan wiedersah, waren die Bilder schwarz-weiß-gold. Dagegen hatte ich das Rot der Heiligengewänder haben wollen statt des Goldes. Ich fragte Bischof Macchi, den Sekretär des Papstes, warum er das so hatte ändern lassen: —Der Heilige Vater liebt das Rot nicht.ž Öfter riet mir Papst Paul VI., ich solle doch Latein oder Italienisch lernen, damit wir uns besser verständigen könnten. Das wäre wirklich richtig gewesen. Einmal erreichte Anneliese und mich in Köln eine Einladung zur Teilnahme an der Christmette in der Sixtina. Auch jetzt wollte sie nicht mitkommen, denn der Papst sollte von uns nicht den Eindruck eines glücklichen Ehepaares haben. Mein Sohn Fidelis, ein Lehrling und ich fuhren nach Rom, wurden aber von den Gardisten erst nicht in die Sixtina hineingelassen. Später gesellte sich noch ein kleinerer Mann zu uns Wartenden. Als alle in den Saal geströmt und die Türen geschlossen waren, kam ein Prälat, der uns von einem Gardisten zum Hochaltar neben einer großen Krippe geleiten ließ. Der Heilige Vater kam auf uns zu und umarmte den kleinen Mann. Ich erfuhr, daß er ein Bruder von Papst Johannes XXIII. war. Auch wir wurden begrüßt und mit Geschenken bedacht. Der Chor sang wunderbar und es war eine großartige Christmette. Nach der Mette fuhr der Heilige Vater zu einer Witwe mit elf Kindern, den Wagen voller Geschenke, und las dort eine heilige Messe. Meine Bilder waren unüblicherweise vom Vatikan bezahlt worden, der dazu einige meiner Emaillebilder versteigert hatte. Bei einer anderen Einladung im Juni 1973 nahm ich meine Tochter Gisela mit nach Rom, denn Anneliese weigerte sich immer wieder mitzukommen. Ein Bus fuhr vor, aus dem Leonhard Bernstein mit seinen Musikern stieg. Ich hörte, dass er extra aus Amerika gekommen war, um in der Sixtina zu spielen. Bernstein und sein Orchester trugen mit einem Chor die für diesen Empfang von ihm komponierten Psalmen vor. Ein ganz großes Erlebnis. Anlass war die Eröffnung einer Kunstausstellung. Marc Chagall, Pablo Picasso, Salvator Dali, Oscar Kokoschka, Wassily Kandinsky, Georg Meistermann: alles, was Rang und Namen hatte, war mit christlichen Kunstwerken präsent. In der Sixtina bekam ich eine Karte mit einem Programm des Empfangs, Empfangsdokumente und auch eine Nachricht, dass ich meine achtzehn Bilder im Saal 37 finden würde. Jeder Künstler sollte den Heiligen Vater vor seinen Bildern persönlich empfangen. Vorher ergab es sich in dem Gedränge, dass Chagall meine Bilder streichelte und mir einen Handkuß zuwarf. Ich wohnte in Rom bei Schwestern im Kloster, wo mich ein Telefonanruf aus dem Vatikan erreichte, ich möge kommen. Vor dem Papst lag ein Emaillebild von mir: —Ja, ich verstehe alles. Warum der Engel keine Flügel hat, kann ich gut verstehen, das würde ich auch nicht machen. Aber warum haben Sie dem Engel einen weißen Hosenanzug angezogen?ž —Heiliger Vater, ich wollte ihm kein Nachthemd anziehen.ž Er lachte und meinte: —Jetzt haben Sie ihm aber einen Pyjama angezogen.ž Ich hatte dem Engel einen weißen Hosenanzug angezogen, weil ich ihn ein bisschen —zivilž bringen wollte. Aber der Papst hatte so hölzern gelacht. —Wissen Sie, ich kann kein deutsch. Da oben steht: —Ehre sei Gott in der Höhež. Schreiben Sie das doch auf Latein, dann können alle Menschen das verstehen. Ihr Künstler seid doch für alle da. Künstler müssen für die ganze Welt arbeiten und nicht national.ž —Gutž, sagte ich, —ich nehme es wieder mit und mache es Ihnen neu mit Nachthemd und statt 'Ehre sein Gott in der Höhe' schreibe ich ,Gloria in excelsis deo'.ž —Nein, nein, nein, ich brauche ja auch Geschenke.ž Er schenkte mir ein Buch in Pergament gebunden mit echten Stahlstichen, ein Original, leider auf italienisch. Er wünschte sich von mir einen Kalender mit heiligen Ehepaaren, den ich erst viel später, 1995, fertigstellen konnte. Vier Jahre hintereinander war ich nach Rom eingeladen worden bis zu meinem Unfall. DER UNFALL 1973 Eine große Glocken- und Kunstgießerei in Herford kämpfte schon lange um ihr Überleben. Kunstguss ist eben lohnintensiv und verlangt hohes Können. Dieser Werkstatt gab ich einen großen Auftrag: eine fünfzehn Meter lange Empore für die Kirche St. Stefanus auf dem Mümmelmannsberg bei Hamburg. Sie waren aber nicht imstande, eine so lange Empore in einem Stück zu gießen, höchstens in Teilstücken, die sie selbst aber nicht zusammenschweißen konnten. In Belgien fand ich ein Unternehmen, das dazu in der Lage war. Sie riefen mich eines Tages zu sich, da drei Zentimeter in der Länge fehlten. Auf dem Weg dahin verunglückte ich schwer. Auf einer Kreuzung zwischen Straelen und Geldern fuhr mir eine Frau mit ihrem Auto bei voller Fahrt in die Seite, so dass ich mir sechsunddreißig Knochenbrüche zuzog. An mein Weiterleben glaubte niemand, als man mich zuerst einmal in eine Wanne legte mit den offenen Brüchen. Anneliese kam einmal vorbei, als der Arzt sie rufen ließ und meinte: —Der stirbt nicht.ž Sie legte einen Haufen leerer Schecks zur Unterschrift vor. So konnte sie das Geschäft weiter führen. Operiert wurde erst nach vierzehn Tagen. Es wurde ein Hüftknochen transplantiert, dabei aber die Gallenblase verletzt und das führte zu einer Nachblutung. Wieder Operation. Trotz der Beschwerden fand ein Geldener Arzt nichts am linken Knie. Aber später musste doch noch eine Wucherung entfernt werden. Ich suchte im Krankenzimmer an der Wand ein Kreuz und fragte, ob sie denn kein Kreuz hätten. Sie zeigten auf ein Kreuz, das in die Wand eingeritzt war. Da sind meine Kreuze, die ich im Leben gemacht habe, wie eine innere Schau an mir vorbeigezogen, und es fiel mir auf, dass ich keinen leidenden Heiland dabei hatte. Da gibt es den Psalm: —Mein Gott, warum hast Du mich verlassen.ž Als ich einmal erfuhr, dass das ein Lobgesang sei, war ich erschüttert. Ein Brief hatte mich darauf aufmerksam gemacht, es sei kein Leidenstext sondern ein Jubeltext. Seitdem versuche ich, den leidenden Vater ab und zu darzustellen. Christus, den sterbenden Heiland, kann man nicht darstellen. Einen Gemarterten, Sterbenden kann man nicht angucken, das tut man nicht. Ein Pfarrer in Marburg hatte für den Aufgang zur Kirche eine heilige Elisabeth in Auftrag gegeben während der Zeit, als ich im Krankenhaus lag. Unsere Tochter Gisela kam zu mir, um zu modellieren. Ich half ihr. Ich konnte mich kaum bewegen. Der Oberschenkel war total zertrümmert. Man hatte die Knochen um eine Stahlschiene gelegt. So waren sie zum Teil wiederzusammengewachsen, aber es hatte sich im Oberschenkel ein zusätzliches Gelenk gebildet, ich konnte das Bein hin und her verdrehen. Bei einer weiteren Operation wurde dem Becken ein Span entnommen, um das Bein wieder herstellen zu können. Dabei stellte sich eine Bauchfellentzündung und eine Darmverschlingung ein. Ich wartete, dass ich —hinübersegelež. Mein Freund Henner Speckmann, der in der Nähe in Cuxhaven evangelischer Pfarrer geworden war, stand auch am Krankenbett. Das Ulkigste aber war, dass ich das Bild an der Wand von Franz Marc - die bunten Pferde - nicht mehr ertragen konnte. In meinem Fieberwahn kamen lauter Hühner aus dem Bild auf mich zu. Henner nahm es weg und rannte nach Hause, um einen Keltertreter von mir zu holen. Keltertreter ist eine Darstellung des gekreuzigten Christus, der die Trauben zu Wein tritt. Als ich das Bild sah, platzte gerade der Knoten im Darm. Das Fieber fiel. Seitdem aber kann ich die Farben rot-blau nicht mehr ertragen. Ich versuche nun, grün und gelb hineinzumischen. Das Blau muss sich auflösen in grün, und das Rot sich auflösen in violett. Blau und grün sind die Hauptfarben und schwarz. Ein paar Tage zuvor war ich noch in einem anderen Krankenhaus gewesen und hatte die —Fußwaschungž modelliert für eine Messdienerplakette zu Pfingsten. Sie brachte eine große Auflage. Auch hier ließ ich mir schon nach einigen Tagen Ton von meinem Gießer bringen, der jede Woche die Modelle zur Weiterverarbeitung abholte, aber nicht nur meine. Die ganze Station modellierte. Lange Zeit war ich auf Krücken und Rollstuhl angewiesen. Nach zehn Jahren konnte ich immer noch nicht ohne große Schmerzen knien. Das änderte sich einmal spontan nach dem gemeinsamen Gebet in einem charismatischen Kreis. Später hörte ich, es hatte an der Empore doch kein Zentimeter gefehlt, derentwegen ich verunglückt war. Man hatte sich nur verrechnet. Nach einiger Zeit der Gesundung machte ich eine falsche Bewegung beim Tragen eines Zentner schweren Tabernakels und riß mir eine Sehne an. ANNELIESE Unser Verhältnis zueinander war sehr spannungsreich. Sie hat mich als Künstler anerkannt. Wir waren immer von dem Verkauf meiner Werke abhängig. Sie machte die Buchhaltung, rechnete ab und zu mit mir ab und zahlte überschüssiges Geld auf unsere Konten ein. Wir hatten ausgemacht, jedes Jahr abwechselnd mit den Kindern nach Spanien zu fahren, doch sie wollte, dass ich mit den Kindern alleine fuhr, weil sie meinte, ich könnte besser mit den Kindern umgehen. Auch gab es so keine Konflikte mit meinen Eltern, die ich ja nach Denia geholt hatte. Anneliese wollte in Köln lieber nur Kunstwerke anderer Künstler und Paramente verkaufen. So mietete ich ihr einen Laden gegenüber. Sie verkaufte auch Schmuck, teilweise sehr guten, teuren, konnte ihn schließlich aber doch nur zum Einkaufspreis loswerden. Dies führte dazu, dass sie immer wieder Geld von mir holen mußte. Als ich in Spanien war, wurde ihr zum wiederholten Male der Laden gekündigt. Darum richtete sie sich zwischenzeitlich auf der Komödienstraße ein. Als ich wieder nach Hause kam, war mein Schlafzimmer vorübergehend als Kunstladen eingerichtet. Es ging schon turbulent zu. Den Laden gegenüber führt heute Gisela erfolgreich. Unserem Sohn Egino half Anneliese umsichtig, seine Silber- und Goldwerkstätte in Wuppertal aufzubauen und Fidelis, unseren Jüngsten, jetzt Architekt in Köln, beriet sie bei seinem Architekturstudium. Ich habe bei Anneliese erfahren, was es heißt, nicht richtig glauben zu können. Als Lehrerin hatte sie die Missio Canonica erworben. Im Kloster lernte ich, Glauben könne man nicht erwerben, das sei ein Geschenk. Bei dem Mystiker Heinrich Seuse las ich: —Man kann sich nur ganz hingeben, willenlos, mit Vertrauen auf Gott, Gott gibt Geschenke, das geht nicht von heute auf morgen, das wird aufgebaut. Es wird nie eine Gnade ganz gegeben.ž Wissen über Gott kann jeder haben, wenn er daran arbeitet. Unser theologisches Wissen baut sich auf Maria auf. Ich bin gegen das Studienwissen, das bringt den Menschen nicht wesentlich weiter. Zu bedenken ist diese Herzenseinfalt, das Herzenswissen, das Marianische Wissen, das unwahrscheinliche Können einer Frau, die Welt zu bewegen durch ihr Dasein, durch ihre Mütterlichkeit, durch ihre Hingabe. Das Hauptkraftfeld liegt in der Frau. Die Gebetswelt muß man sich erarbeiten, sie kommt nicht von heute auf morgen. Frömmigkeit und Gnade sind ein Geschenk Gottes, meist wird es von einem Außenstehenden erbeten. Treue in der Ehe ist auch ein langer Weg. Liebe zueinander wächst von Tag zu Tag. Soweit Egino. Anneliese war eine schöne, intelligente, aufgeschlossene Frau. Sie führte elegant, gekonnt und sprachgewandt das Geschäft mit viel Engagement. Sie hatte ein gutes Formempfinden und konnte witzige Sachen malen. Ihre Kritik brachte ihren Mann zum Aufbrausen. Er nahm sie sich aber öfter auch zu Herzen. Den Fremden gegenüber, die das Atelier aufsuchten und ihr Herz ausschütteten, hatte sie ein offenes Ohr. Die Kunden fühlten sich bei ihr aufgehoben. Sie hatte alles im Kopf und gab dem einen oder anderen auch mal einen Nachlass. Betraten Klosterschwestern das Atelier, bekamen sie unauffällig einen großen Schein in die Hand gedrückt. Die Kleinkinder im oberen Geschoß des schmalen Hauses wurden meist von angestellten Frauen betreut, die der Vater Egino besorgte und die Mutter Anneliese oft wieder entließ. Außer dem Ältesten, der sich sträubte, wuchsen die Kinder in christlich geführten Internaten auf, entgegen den Vorstellungen des Vaters. Alle vierzehn Tage fanden sich alle am heimischen Herd ein. Früher konnten die Kinder ihren Vater nicht einschätzen, der sie in ihren Ferien in Denia zu Reparaturarbeiten und Kartoffelschälen anhielt, denn für ihn gab und gibt es keine Ferien. In den entspannenden Ruhezeiten denkt und plant er immer wieder. —Vater achtet jedes Stückchen Brot und ist streng gegen sich selbst, schleppt sich auch unter starken Schmerzen, die ihn seit dem Unfall in vielen Varianten immer wieder befallen, noch zur Kirche. Heute bewundern wir ihn. Wir freuen uns immer, wenn er und Waltraud unsere Großfamilie festlich um sich versammelnž, erzählte eins seiner Kinder. 1977 wurde Anneliese bettlägerig. Sie hatte Krebs. Die Krankheit nahm von Annelieses Körper immer mehr Besitz. Wenn ich sie am Krankenbett besuchte, nahm ich Plastillin und Zeichenblock mit ins Krankenhaus. Ich habe mich stundenlang mit ihr unterhalten. Sie wollte wissen, dass ich da war. Ihre Augen waren erblindet. Da ist mir etwas Furchtbares passiert: Ich malte ein Pfingstbild und sagte zu ihr: žGuck mal hier dieses Bild. Ist es nicht schön geworden?ž und hielt ihr das Bild hin. Sie wurde böse, griff immer wieder danach, wohl um es zu zerreißen, als wollte sie sagen, höre auf mit deiner Pinselei und unterhalte dich lieber mit mir. Das ist aber auch so eine Eigenschaft von mir. Ich bin so eingenommen von meinen Sachen, dass ich immer meine, alle sollen daran teilhaben. Als Vorleselektüre bevorzugte Anneliese vor allem Teilhard de Chardin, Paläontologe, Philosoph und Theologe, der von 1881-1955 lebte. Ich habe Anneliese noch kurz vor ihrem Sterben vorgelesen, dass der Heiland sagt, wir werden in den Geist Gottes eingehen. Der Tod ist Auflösung der körperlichen Materie, und die geistige Materie geht in den Geist Gottes über, der ewig ist. Daraufhin sagte sie, das sei der schönste Satz, den ich ihr hätte vorlesen können. Das stand gerade in der Kirchenzeitung auf der ersten Seite. Kurz vor ihrem Tod, als ich ihr das Vaterunser vorbetete, mahnte sie plötzlich: —Du hast aber vergessen den Satz: Zu uns komme Dein Reich!ž Ich hatte ihn bestimmt nicht vergessen. Nach einer Weile sagte sie: —Egino, du bist doch der beste Mensch der Welt.ž Das war das Schönste, was sie mir sagen konnte. Sie rief mir zu: —Priester holen.ž Ich habe das nicht verstanden und dann aber wieder —Priester holen!ž Morgens um zehn stürmte ich noch los, Eis zu holen für sie. Sie atmete noch. Als ich um elf zurück kam, sagte mein Sohn Clemens: —Mutti ist tot.ž Sie hielt das Kreuz mit dem —Ungläubigen Thomasž in der Hand. Ich war wie betäubt. Erst später fiel mir die Voraussage ein, die Bischof Esser aus Afrika mir 1952 übermittelt hatte: —Ihr nächstes Kreuz mit Ihrer Frau, das wird so schwer, dass Sie darunter zerbrechen. Das ist unmöglich, das können Sie nicht. Anneliese wird vom Glauben abfallen und wenn der Heiland nicht im letzten Moment eingreift, wird sie verloren gehen.ž Ich habe sie geliebt bis zum letzten Atemzug. Der evangelische Militärbischof Kunst brannte seit langem darauf, meine Ausstellungsräume zu sehen. Als er 1985 endlich kam, war er ganz erschüttert. Ich hatte Anneliese gerade darin aufgebahrt. Mein Atelier in Königsdorf hatte Anneliese nie betreten wollen. Im rechten Seitenschiff des Kölner Doms vor dem Stephan-Lochner-Altar wurde die Totenmesse gelesen, da, wo auch unsere Hochzeit stattgefunden hatte. Ich gehe, wenn es mir kräftemäßig erlaubt ist, immer gerne zum Dom. Ich meine, dass das Leid nicht von Gott kommen kann. Das Leid kann nur von einer anderen Welt kommen, die uns nicht mag und uns durcheinanderbringen will. Wenn du an die Liebe Gottes nicht glaubst, nicht glaubst, dass er dich lieb hat, sich um dich bemüht, dass er dich einlädt zum Erlösungswerk, das er uns ja vorgeführt hat, dann fehlt einfach die Lebens- und Liebesgrundlage. Wir müssen uns entschuldigen, für das, was wir gemacht haben. Der Heiland hat für uns alle Blut geschwitzt. Wir sind eingeladen, an diesem Erlösungswerk teilzunehmen. Auch das Bemühen um die armen Seelen finde ich enorm wichtig. Denn wir sind auf die Verstorbenen angewiesen, die im Himmel vor dem Heiland für uns bitten. Sie können uns die eine oder andere Gnade, derer wir bedürfen und die wir von uns aus nicht erwerben können, erwirken. Soweit Egino. Nach dem Tod von Anneliese dachte er zuerst daran, ins Kloster zurückzugehen. Geistliche rieten ihm aber zur Heirat, denn er hatte inzwischen durch ein befreundetes Ehepaar Waltraud Förster kennengelernt, eine geschätzte Krankenschwester. —Anneliese ist aber in unserem Geiste nicht ausgeschlossen,ž sagt Egino. Die Hochzeit fand im Kölner Dom im Herbst 1985 statt. Die Hochzeitsfeier wurde in dem Atelier in Königsdorf begangen. Dazu erschienen viele Freunde des neuen Ehepaares. Mit ihrem Engagement und ihrer Kochkunst ermöglicht Waltraud seitdem immer wieder Treffen, Begegnungen und Vorträge der Benediktiner in Königsdorf (einem größeren, umgebauten Gasthaus mit labyrinthisch anmutenden Gängen und Räumen). Sie haben nie gedacht, dass Treffen dort solchen Anklang finden. Im Geschäft ist Waltraud sachkundig, weil sie in kirchlichen Dingen und von den Heiligengeschichten viel weis und Laien und Kleriker beraten kann. ROM 1985 Seit der Hochzeit begleitet Waltraud ihren Mann auf fast allen Reisen. Egino berichtet weiter: 1985 weihte Papst Johannes Paul der II die päpstliche Musikhochschule St. Hieronymus auf der Via Aurelia in Rom, einen großer Baldachin über der vorgezogenen Altarinsel. In drei Wochen mußte alles fertiggestellt sein. Hieronymus! Wenn wir ihn nicht hätten! Er sammelte und übersetzte die Heiligen Schriften. Die Arianer zerstörten seine Bibliothek und verbrannten sie. Schriften von ihm blieben erhalten, weil er in dreißig Schreibstuben arbeiten ließ. Das ist nicht so bekannt, dass Frauen ihr Vermögen gaben, damit es möglich wurde. B.: —Die Menschen sind oft in sexuellen Versuchungen, sonst hätten sie nicht so viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen.ž E.G.W.: —Die Sexualität ist das A und O im Leben. Deshalb hat sich Hieronymus in Stacheln und Dornen gewälzt, ähnlich wie der heilige Benedikt. Hieronymus ist nicht so schnell heilig gesprochen worden. In den Darstellungen liegt immer ein Löwe zu seinen Füßen - die heilige Paula. Sie muß Macht auf ihn ausgeübt haben, aber eine sehr kluge Frau gewesen sein. Sie suchte, um zu lernen, den Mönch Antonius in der Wüste auf. Ägypten, Rom, Jerusalem, was sind das für Entfernungen! Und die Gefahren! In Ephesus wurde sie überfallen und beraubt, was sie zwang, nach Rom zuückzukehren, um Güter zu verkaufen. Aber um auf Rom zurückzukommen: Mit einem großen Hängekreuz, das ich zusätzlich zur Auswahl mitgenommen hatte, schickte ich meine Gesellen mit dem Lastwagen nach Hause. Sie sollten sich aber vorher noch Rom und Florenz anschauen. Die Polizei kontrollierte sie an der Schweizer Grenze. Als sie im Auto das große Kreuz fanden, beschlagnahmten sie es als Diebesgut. Meine Leute konnten sich nicht verteidigen, allein schon der Sprache wegen. Sie besaßen keine Unterlagen und so mußte ich hinfahren. Die Polizei, der Pfarrer, keiner glaubte mir. In meiner Not suchte ich oben in Montevarese Erzbischof Macchi auf, das ist der, der mich damals bei meinem Besuch bei Papst Paul VI. betreute. Er rief die Polizei an, aber obwohl er sich für uns verwendet hatte, holte die Polizei erst Fachleute zur Schätzung des ,Diebesgutes' herbei. Weil ich wahrheitsgemäß den Wert von 4.000 DM angegeben hatte, war auch ich verdächtig. Inzwischen schätzten die herbeigeholten Fachleute den Wert des Kreuzes auf mindestens sechzigtausend Mark. Danach aber wollten sie es plötzlich alle zu meinem Preis kaufen. —Neinž, sagte ich ihnen, —das war nur für den Vatikan so gedacht.ž ORIGINAL UND ABGUSS Aus einer Munitionsfabrik entwickelte sich nach dem Krieg eine Ortschaft, Espelkamp bei Herford, heute eine Stadt. Ich entwarf 1989 eine Bürgermeisterkette mit ostdeutschen Wappen, gestiftet von dem evangelischen Bischof.Kunst. Eine sehr wertvolle Arbeit, von der ich Postkarten anfertigen ließ. Bischof Kunst, ein großer Kunstfreund, ließ sich jedes Jahr eine Plastik anfertigen, die er auf den einzelnen Stufen vor der Kirche aufstellte. Er wollte immer Originale haben. Ich sagte zu ihm, ich wüßte gar nicht, was er unter Originalen verstände, jedes gute Stück sei ein Original. Auch, wenn es fünf-, zehnmal abgegossen wird, bleibt es immer noch ein Original, ein Kunstwerk. Er erzählte, er habe viele Plastiken von Barlach. Die Bildhauer haben die Großplastiken, die bis zu einer Millionen kosten, zehnmal abgegossen. Die Plastik, die beim Bundeskanzleramt steht, ich glaube, sie ist von Mirò, existiert zum Beispiel zehnmal in der ganzen Welt. Nach meinem früheren Kuraufenthalt in Wangen als Gast des Fürsten von Thurn und Taxis war ich noch einige Male bei ihm in Regensburg zu Gast. Ein Kölner Geistlicher und begeisterter Musiker wurde Hausgeistlicher auf dem Schloß des Fürsten und besitzt da eine Orgel, ein Geschenk seiner Mutter. Sie betrat eines Tages mein Atelier in Köln und gab mir den Auftrag für einen Tabernakel in Hongkong. Der Fürst hat mich auf seinem Schloß bewirtet. Wir waren in seiner Gaststätte. So ein schönes Gästeschloß, in dem der Geistliche und auch ich untergebracht waren. Der musikalische Kaplan lud zu einem Orgelspiel ein. Der Fürst und die Fürstin, wir alle waren hingerissen. Später zeigte mir die Fürstin ihre Sammlung von Edelsteinen und breitete sie auf einem Tuch vor mir aus. Was sie an noch unbeschliffenen Edelsteinen besaß, hatte ich noch nie gesehen, Rubine, Smaragde ... Wir drei saßen noch zusammen und tranken. Dann schickte der Fürst die anderen zu Bett, lud mich aber noch mit seinem Förster zu einem Spaziergang durch die Gärten ein. Das war traumhaft, wir wandelten durch das Labyrinth, aber ich war schon halb beschwipst. Nachher hat er mich noch in seine Brauerei geführt. Da habe ich noch mit seinem Braumeister getrunken. Soweit Egino. KARMELITINERINNENKIRCHE IN AVEIRO (PORTUGAL) An einem Abend im Jahre 1994, als wir zusammen mit dem Ehepaar Weinert auf der Terrasse ihres Hauses in Denia saßen, erreichte den Künstler ein Anruf aus Köln mit der Ermutigung, er möge sich mitbewerben um die Einrichtung einer Karmelitinerinnenkapelle in Aveiro, Portugal. Nach seiner Rückkehr erzählte er, er habe in Aveiro Schwester Lucia getroffen, das älteste der Seherkinder aus Fatima, die aus ihrem Stammkloster in Coimbra angereist war. E.G.W.: —Sie lebt gar nicht mehr in dieser Welt ...ž B.: —Du bist ihr also begegnet?ž E.G.W.: —Ja, durch die Kapellengestaltung. Sie stand vor dem kleinen Gremium von Künstlern und Architekten. Sie hat mich gesehen, hat die Schwestern zusammengerufen und gesagt: —Der macht das. Nichts sagen. Nichts fragen. Der macht das.ž B. liest aus einer Broschüre: —Sie ist die Älteste der drei Hirtenkinder, Lucia, Francisco und Jacinta, die noch lebt seit der Marienerscheinung in ihrer Kindheit 1917. Francisco und Jacinta starben im Kindesalter (sie wurden selig gesprochen im Jahr 2000 durch Papst Johannes Paul II.). Den Kindern erschien vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 in Fatima die Gottesmutter und mahnte zum täglichen Rosenkranzgebet zur Buße und verlangte die Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Sie wurden von einem Engel gelehrt zu beten, wie Lucia später berichtete: —Auf die Erde knieend beugte er sich, bis seine Stirn den Boden berührte und ließ uns dreimal die Worte wiederholen: Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich. Ich bitte um Verzeihung für jene, die an Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht hoffen und Dich nicht lieben.ž E.G.W.: —Das war die Botschaft an die Kinder. Sie waren erst zehn, acht und sechs Jahre alt. Mich wundert, dass sie von dem Engel unterrichtet wurden, in der Form der Araber zu beten. Aber das ist noch nicht von der Kirche angenommen worden. Tiefer können wir uns vor Gott nicht verneigen. Manche nehmen diese Gebetshaltung sehr gern ein, wenn sie allein sind. Dabei erleben sie mehr, als wenn sie so wie üblich beten. Wenn wir das Beten in der Form und Tageszeit der Mohammedaner einführen würden, hätten wir eine Verbindung mit ihnen. Es würde deutlicher, dass wir denselben Gott anbeten. Der Rosenkranz gibt uns Zeit, uns mit der Offenbarung und mit dem, was uns Gott schenkt, gedanklich zu vereinigen. Ob es nun nötig ist, fünfzig Ave Maria zu beten, ist eine andere Frage. Ich glaube, wenn man ein Gesätz mit Ruhe und Zuneigung betet, hat man vielleicht mehr geleistet. Vielleicht. Ich will mich da nicht festlegen. Denn nicht die Gefühle, sondern der Wille, sich Gott zur Verfügung zu stellen, ist maßgebend. Wir kennen ja viele Heilige, die mit Mühe und Widerwillen gebetet haben. Viele Heilige hatten große Krisen beim Beten. Glaube ist Aktivität, sich aufmachen auf einen Weg, ein Mühen auf eine Sache hin. Ich glaube, viele zu kennen, die sagen, sie glauben nicht. Das liegt daran, daß sie sich keine Mühe geben. Ich habe auch als Junge meine Zweifel gehabt, aber ich habe mir gesagt, glauben ist mehr wert als nicht zu glauben. Ich habe die Freiheit zu glauben, und ich habe die Freiheit, nicht zu glauben. Aber die Aktivität zu glauben bringt enorm viel Glück. Zuerst natürlich nicht, das kommt erst langsam und mit dem Glauben kommt das Wissen. Man wächst ja auch an der Sache.ž DER GLAUBE IST EIN GESCHENK Im Wallraf-Richartz-Museum sind Lochner-Madonnen, aus denen ein richtiger Gaube, eine Liebe spricht. Ich gehe sehr gerne zu der Schiffer-Madonna in —Maria Lyskirchenž in der Peter Heckel gemalt hat. Aber das Bild erkennt ja keiner es ist sehr dunkel - und der Künstler ist bis heute fast nicht bekannt. Aber daraus spricht soviel Glaube und Liebe wie in den wenigen religiösen Bildern von Emil Nolde, die er für die Kirche in Mechern gemalt hat. Sie sind großartig. Er hat Formen und Farben benutzt, die uns fremd sind, um seinen Glauben zu zeigen. Er ist nicht anerkannt worden. Oder der Maler Windelschmidt, der nach seinem juristischen Staatsexamen nur gemalt hat, und später hungerte. Herrliche Bilder. Eines Tages werden sie für eine große Zeit in unserer Epoche stehen. Ich habe einmal einen Kreuzweg von ihm gesehen, der war so schön, dass er mich erschütterte. Am liebsten hätte ich ihn geklaut. Er hing unbeachtet in einer Kirche. Zum Malen gehört viel Glaube, Glaube und Können. Man muß seinen Glauben und sein Können in seinem Werk sichtbar machen. Das verstehen nur ganz wenige. In Kopenhagen habe ich einmal einen Vortrag in einem Gasthaus gehalten. Es heißt ja, Christus habe in einer Gaststätte sein Abendmahl gefeiert. Gerade die Menschen, die an der Theke stehen sind es, die Kontakt suchen, gehört werden wollen. Ein Thema, das einmal ein Exerzitienmeister, Arbeiterpriester aus Marseille, aufgegriffen hat. Ich bin überzeugt, dass Gastwirte, Diakone oder Priester an so etwas denken sollten um Leuten, die suchen, etwas geben zu können. —Da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind...ž Das ist mein Anliegen. In Königsdorf wollte ich in unserem Haus eine Theke einrichten. Aber Anneliese war dagegen. Du kannst jeden Tag dem lieben Gott danken, dass du glauben darfst. Wir können dem lieben Gott nichts anderes schenken als unseren Glauben. Wir können nur unseren Glauben bieten, unsere Bereitschaft zu glauben darbieten und immer wieder dankbar sein, dass wir glauben können. Sich ganz zur Verfügung stellen in der Kommunion. Die Kommunion ist ein großartiger Glaubensakt für uns Menschen. Das ist es, was uns so sehr verbindet, dass wir aus dem gleichen —Stallž kommen, dass wir immer wieder am Glauben Freude haben, am Glaubendürfen, am Glaubenkönnen, aber auch am Zweifel, der uns immer bewegt. Über den Zweifel wegspringen, das machst du doch auch. Du springst über den Zweifel weg, weil der Glaube viel erhabener ist als der Zweifel. Die Sünde mußt du als Sünde belassen. Du mußt den Widersacher Gottes, der uns täglich Aufgaben aufgibt und uns Fallen stellt, erkennen und selbst bekämpfen. Wir sind in allen Minuten lauter Versuchungen ausgesetzt. Wir wissen gar nicht, was wir wirklich selber gesündigt haben und wo der Teufel eigentlich der Schuldige ist, wo wir nur mitgezogen und in die Irre geführt werden. Wir müssen beten und Opfer bringen, damit die Welt im Gleichgewicht bleibt. Wir sollten auf gewisse Dinge verzichten und uns nicht alles leisten, was wir uns leisten können. Wir müssen uns trennen von den Sachen dieser Welt. B.: —Man bittet für andere um Verzeihung? Man steht selbst vor Gott und muß dafür einstehen oder haben wir lauter Stellvertreter?ž E.G.W.: —Du kannst doch für deine Kinder bitten, du kannst doch für einen anderen, der Schulden hat, die Schulden übernehmen und das wieder in Ordnung bringen. Ich bete jeden Tag den Rosenkranz, und wenn ich in Denia am Strand bin, nehme ich Muscheln als Gedankenstütze.ž Nach der Einrichtung der Kirche der Karmeliterinnen in Aveiro wurde E.G.W. mit der Renovierung der ungarischen Stephanus-Kapelle in Fatima beauftragt. Sie steht auf der kargen Bergweide nahe der Stadt Fatima, wo die drei Hirtenkinder die Erscheinungen hatten. Schon 1985 hatte er nördlich von Bologna, in Galeazza, eine kleine Kirche des Klosters der Servitinnen eingerichtet. 1995 wurden in dem weiträumigen Garten des Klosters sieben Emaillebilder, die die Darstellung der sieben Schmerzen Mariens zum Thema haben, in überdachten, gemauerten Stelen aufgestellt. Danach wurde er mit Waltraud zu einem Festakt eingeladen, wo ihm wurde die Ehrendoktorwürde der Universität Bologna verliehen wurde. GLAUBENSVERKÜNDIGUNG DURCH KUNST Egino sagt: —Gott offenbart sich durch viele Dinge. Gott gibt uns Hilfen. Das erleben wir immer wieder in der Geschichte, dass der Heiland durch den Menschen wieder neu lebendig wird. Man denke an Fatima und viele andere Dinge. Gott ist immer wieder da. Er läßt uns nicht alleine. Wenn man das Alte Testament durchgeht, staunt man immer wieder, wie oft sich Gott durch Wunder, durch Propheten, durch irgendwelche Dinge darbietet und um die Menschen wirbt. Der Glaube braucht Formen, der Glaube braucht Mut. Ich möchte gerne einen Seitenaltar bemalen, so wie durch alle Jahrhunderte einem Kunstschaffenden die Möglichkeit gegeben wurde, eine Säule oder eine Wand einfach so zu bemalen.ž B.: —Kannst du sagen, durch meine Kunst, durch meine Art der Aufhellung der Glaubensgeheimnisse ist jemand Jesus näher gebracht worden?ž E.G.W.: —Doch, zumindest bereichert worden. Ich denke da an eine Entwicklungshelferin, die von dem Bild —Der Keltertreterž so beeindruckt wurde, dass sie in ein Karmelitinerinnenkloster in Süddeutschland eintrat. 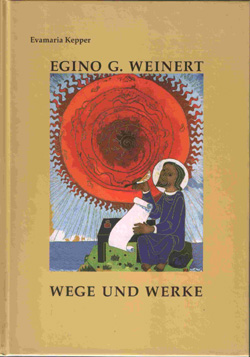  |
||||||||||||
 |
|||||||||||||
| Bezug: Direkt durch Bestellung per Post (Brief/Postkarte) an: Dr. Evamaria Kepper Lacherstraße 44 D-42657 Solingen PREIS: 19,80 Euro |
|||||||||||||
| Für mehr Informationen zu EGINO WEINERT klicken Sie bitte HIER ! |
|||||||||||||
|
Impressum: Verantwortlich
für den Inhalt dieser Seiten: Tel. 0212-812617 |
|||||||||||||
|
- S E I T E N E N D E -
|
|||||||||||||