|
Goldschmied Maler und Bildhauer |
 |
| INHALT STARTSEITE DIE AUTORIN BESTELLEN BUCHHANDLUNGEN Kritiken in der Presse: Pressestimmen-1 Pressestimmen-2 Aus dem Buch: DER KÜNSTLER EGINO G. WEINERT ALS LEHRLING Als Bruder im Kloster Münsterschwarzach Rausschmiss aus dem Kloster Begegnung mit Picasso Begegnungen mit den Päpsten AGBs Kontakt IMPRESSUM |
EVAMARIA KEPPER (AUTORIN) EGINO WEINERT LEBEN UND WERK  AUS DEM INHALT Einzug in Köln mit Atelier und Werkstatt 1956 Kreuze in alle Welt Bregenz 1966 Amerika —Liturgie ist ein Tanzen um Gottž (Picasso) Werke modernisieren Türe als Karikatur Werkstatt in Denia (Spanien) Aufträge im Ausland Nuntius Heim Kontakte mit dem Vatikan Der Unfall 1973 Anneliese Rom 1985 Original und Abguss Karmelitinerinnenkirche in Aveiro (Portugal) Der Glaube ist ein Geschenk Glaubensverkündigung in der Kunst Aus der Werkstatt geplaudert Das Geheimnis Fischleim Freude bei der Arbeit Ein grünes Gesicht Wie ein Emaillebild entsteht Über den Handel mit Edelsteinen Als die Kripo kam Ein Dieb im Laden Erfahrungen mit Reliquien Kritische Situation Ein Pferd, gegossen aus drei Kilogramm Gold Das Goldbad Feuervergoldung Ein Verfahren für kleine Objekte Eine Madonnenskulptur in Velbert Gießen mit der Handschleuder Gründung von Gießereien Alle Platten gleich groß Töpferei in Adendorf Kreuze als Zeichen des Glaubens Erzählungen Der Kelch von Goldschmied Wimmer Ein Kelch wird zurückgegeben Anhang Erzbischof Bruno B. Heim über Egino G. Weinert Monsignore Dr. Franz Ronig, Professor für Kunstgeschichte in Trier Ausklang Kurzer Lebenslauf Vita des Künstlers Quellennachweis Verzeichnis von Begegnungen Bildanhang  EXPOSE ZU DEN WERKEN VON EGINO G. WEINERT- Sein Werk macht den Glauben sichtbar. Jedes Teil ist mit Liebe und Sorgfalt überdacht und gewählt. Der Ideenreichtum ist überwältigend. Jede Farbe und Form ist überlegt und abgestimmt, überstrahlt von einfacher, betörender Frömmigkeit. Bei der Fülle der Werke sieht man in allem die persönliche Handschrift des Künstlers unverkennbar. Ob er die weit über Tausend Gestalten der Heiligen oder die des Alten und Neuen Testaments in ihrem Umfeld darstellt in Emaille, in Bronzereliefs oder Skulpturen jede ist individuell geschaffen, hat ihren eigenen Charakter. Wer in eine Kirche durch das von ihm entworfenene und gefertigte, kupferne (oder bronzene) Portal geht - hinein schreitet, wird in besonderer Weise eingestimmt. Bei näherem Betrachten fällt der Blick auf einen von ihm entworfenen Altar, darüber ein Hängekreuz mit Emaillebildern, einen Tabernakel, oder auch einen Ambo (Lesepult), ein Leuchter und ein Taufbecken, alle aus seiner Werkstatt. Sie haben meistens die Heilsgeschichte zum Thema. An den Seitenwänden befindet sich oft ein von ihm modellierten Kreuzweg in Bronze oder Emaille. Ein während der Messfeier benutzter von ihm gestalteter Kelch besticht durch die schlichte Form, (verziert mit Bergkristallen, Edelsteinen oder Granulationen). Seine Werke harmonisieren auch mit Werken anderer Künstler. Egino G. Weinert verwendete zum Beispiel in der St. Michaelskirche in Solingen bei der Gestaltung des Altarkreuzes gerne einen Corpus Christi, der bereits von einem anderen Künstler, W. Füssel, gestaltet, vorlag. Zu dem dunklen Corpus wählte er einen ungewöhnlichen weiss-grünlich schimmernden Hintergrund aus Emailleplatten, die er mit Golddraht umwickelte. Unauffällig von weitem, nur von der Seite einsehbar, verläuft rings um das Kreuz ein buntes Band mit dreißig Emailleplatten, auf denen die Heilsgeschichte Jesu abzulesen ist. Es wurde geschaffen 1964, noch unter dem Eindruck der Kriegserlebnisse. Besonders erinnert das drahtumwickelte Kreuz an die —einzigartige Kirche der Heiligen Familie in Birerod-Nordvanggaard in Dänemark, wo das Kreuz, der Altar, der Tabernakel den Blick auf sich ziehen und besonders auch der Kreuzweg aus Steinen und Stacheldraht mit Kreuzwegbildern in Emaille darüber. (Erzbischof B. Heim) Weinerts Stil, die Dinge zu erfassen und darzustellen, hat sich im Laufe der Jahre gewandelt, wie ein Vergleich des beschriebenen Hängekreuzes (1964), mit späteren Werken zeigt. Die frühen Arbeiten haben noch den Hauch der klösterlichen Atmosphäre. Die Darstellung des Auferstandenen ist von behutsamer Zurückhaltung, aber eindringlich. Der Auferstandene erscheint in rotem Gewand auf hellerem Rotuntergrund. In dunklen Blau stehen - klein im Hintergrund - die drei Frauen und im Vordergrund, fast strichhaft in lebhafter Gestik, zwei betroffene Soldaten, gemalt in dunklem Blau. Das Gesicht Jesu ist grün gehalten mit weißem Haarkranz, schwarzer Dornenkrone auf sich wiederholendem Blaugrund, eine überstahlende, sprechende Gestalt. Ganz schlicht. Die Augen sind eingeschlossen von geschwungenen, dünnen linienhaften Augenbrauen, die in eine schmale Nase auslaufen und den Gesichtsausdruck prägen mit dem in einer winzig gewundenen Linie hingetupftem, roten Mund. Alle Linien sind wie gemalt. Die Farben sind noch rot, blau, weiß und schwarz. Im Laufe der Zeit wurden die Farben durch die Hinzunahme anderer Farbnuancen geändert: —Das Blau muss sich auflösen in Grün, das Rot sich auflösen in Violettž sagt der Künstler. Farbkompositionen entstehen von faszinierender Eindringlichkeit. Die Figuren, auch in den Halbreliefs, werden in der Folgezeit des künstlerischen Schaffens deutlicher, kräftiger, gedrungener, individuell geprägter, abgewandelter, ausdrucksstärker, plastischer und abgewandelt reich an immer neuen Ideen. Die Plastizität auf den Emaillebildern wird erreicht durch den Gebrauch von gebogenen Drähten zur Schattengebung und Darstellung von Ornamenten, eingesetzt zur Verstärkung des sprechenden Ausdrucks. Für seine unverkennbare und unverwechselbare Gestaltung wendet der Künstler seine eigene Technik an; Wirkung verleiht der gebogene Draht, den zu biegen der Meister mit seiner einen Hand beherrscht. In die entstehenden Felder werden in mehreren Arbeitsgängen die Farben eingebracht: die Zellenschmelztechnik. HERR PROFESSOR DR. RONIG ÜBER DEN KELCH IN TRIER Eindrucksvoll schildert Prof. Dr. Ronig die tiefe und innige, in einem ganz besonderen Wert sich zeigende Kunst und Religiosität von Egino G. Weinert. Über einen zu Ehren Bischofs in Trier gefertigten Kelch heißt es: Unter den vielen Arbeiten, die Egino Weinert für Trier und die Diözese Trier geschaffen hat, ragt ein Kelch hervor, der für die Feier von Konzelebrationen im Trierer Dom 1995 angefertigt wurde. Der Anlaß war die Vollendung des siebzigsten Lebensjahres des damals amtierenden Bischofs Dr. Hermann Josef Spital. So wurde dieser Kelch zu einer Geburtstagsgabe für den amtierenden Bischof. So ist es auch in der Widmungsinschrift auf der Unterseite des Fußes vermerkt: —Dem Bischof der Trierischen Kirche Dr. Hermann Josef Spital zur Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres in Verehrung und Dankbarkeit das Domkapitel und die Domvikare am 31. Dezember 1995.ž Das bischöfliche Wappen trägt die Inschrift: —Redemptor hominis decus nostrum et gloria. Der Erlöser des Menschen - unsere Zier und unser Ruhm.ž - Dieser Kelch soll nun genauer beschrieben und einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Da die Kelche in —Normalgrößež auf dem Altar des Trierer Domes, vor allem für die weiter hinten sitzenden Gläubigen (und auch im Raum) als optisch zu klein erscheinen, war die Anschaffung eines größeren Kelches angezeigt. Außerdem bestand bei größeren Konzelebrationen gerade zusammen mit dem Bischof, die Mißlichkeit, daß das Fassungsvermögen der kleinen Kelche zu gering für alle Konzelebranten ist. Darum mußten mehrere Kelche auf den Altar gestellt werden, Das wiederum widerspricht (phänomenologisch gesehen) der Idee des einen Kelches, ja verdunkelt diese Idee geradezu. So griff man also auf die uralte Tradition zurück, einen großen Kelch mit entsprechendem Fassungsvermögen anfertigen zu lassen. Das bevorstehende Jubiläum des Bischofs bot dazu einen guten Grund. Die Höhe des neuen Kelches beträgt 31,5 cm, die Kuppa hat einen Durchmesser von 14,5 cm, der Fuß von 17,4 cm. - Die zugehörige Patene mißt im Durchmesser 24,5 cm, in der Höhe 4,00 cm; die innere Vertiefung hat einen Durchmesser von 15,3 cm. Da in Fragen der Grundform eines Kelches nur wenige Varianten möglich sind, war die Entscheidung über die Form (im Sinne seiner Silhouette) vom Künstler schnell festgelegt. Die oval geformte Kuppa wird von einem trompetenförmig aufsteigenden Fuß getragen, aus dem der Nodus im Übergang herauswächst. Die profilierte Zarge läßt den Fuß - auch optisch - fest auf seiner Unterlage stehen. Die Oberfläche des vergoldeten Silbers ist stellenweise in Reliefs getrieben oder auch graviert, vor allem aber mit figürlichem Email belegt. - So sind am Fuß und auch am Nodus solche abstrakten Ornamente zu sehen, die an das Wurzelwerk eines Weinstockes erinnern - eine Anspielung auf die Darstellung des Weinstockes auf der Kuppa. Die Kuppa wird von einem (nicht versenkten, sondern) in Kastenform aufgelegten Email geschmückt, das nicht die ganze Fläche bedeckt, sondern die Grundfläche weitgehend sichtbar läßt. Das Email und sein Rahmen (—Kastenž) stehen daher erhaben über der Grundfläche. Da es sich bei dem Großteil der Gesamtfläche um das Geranke eines Weinstocks mit Blättern und Trauben handelt, bleibt natürlicherweise ein relativ großer Anteil des Metallgrundes unbedeckt. Die Ranken dieses Weinstocks umfassen auf der —Vorderseitež der Kuppa die ebenfalls in flachen Kästen aufgebrachte Emailmalerei einer Darstellung Christi in der Kelter. Die theologische Bedeutung dieses Bildmotivs und der gesamten Ikonologie des Kelches soll weiter unten erläutert werden. Die Lippe des Kelches wächst in glatter Fläche aus dem mit Email geschmückten —Korbž nach oben heraus. Die Kuppa sollte nicht selbst und unmittelbar die Dekoration tragen und ist deshalb von dem Korb umgeben. So entstand, einer alten Tradition folgend, eine doppelwandige Kuppa. Der Grund für diese Art, einen Kelch zu konstruieren, liegt sowohl in der Rücksicht auf den praktischen Gebrauch, als auch in der Ehrfurcht vor der das Allerheiligste bergenden Kuppa. - Eine wenig tief gravierte Inschrift umläuft die Lippe. Es ist ein Psalmwort (115,13), das in der Feier der heiligen Eucharistie seit vielen Jahrhunderten eine wichtige Rolle spielt: —Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabož - —Den Kelch des Heiles will ich ergreifen und den Namen des Herrn anrufen.ž Mittelpunkt des Schmuckes der Kuppa ist die Darstellung Christi des Gekreuzigten in der Gestalt des Keltertreters und des zugleich Gekelterten. Christus hängt am (in braunem Email getönten) Kreuzesbalken. Er ist mit einem blauen Lendentuch bekleidet und trägt die Dornenkrone; sein Haupt ist von einem weißen Nimbus umgeben. Die anatomische Binnenzeichnung im Inkarnat des Körpers ist durch feinste Goldfäden angedeutet. Über dem Haupt Christi und über der Mitte des waagerechten Kreuzbalkens erscheinen die Schraube und das Gewinde der Kelter, über ihnen die Kreuzesinschrift —INRIž: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Christi linker Fuß steht in dem holzfarbenen Kelterbottich (auf dessen Reifen die Künstlersignatur —Wž eingelassen ist), während der rechte zum Zertreten und Zerstampfen der blutroten Trauben angehoben ist. Aus den Wunden der Hände und des Herzens fließen Ströme von Christi Blut nach unten. Durch die Einbettung dieser Darstellung in das Geranke eines einzigen, sich nach rechts und links über die ganze Kuppa verbreitenden Weinstocks ist der ikonographische und theologische Zusammenhang mit dem Bedeutungsfeld der biblischen Weinstockgleichnisse des Alten und des Neuen Bundes hergestellt. Der Weinstock und seine Rebzweige wachsen hinter dem Bottich aus dem Kreuz heraus und bewegen sich in abstrakt-geometrischen Figuren über die Fläche; seine Farbe changiert zwischen grün und blau. An ihm wachsen Ranken, Blätter und rote Trauben. Die Idee, das Erlösungsgeschehen, hier also Christi Opfer für die Menschheit am Kreuz, mit der Vision des alttestamentlichen Keltertreters in Verbindung zu bringen, geht bis in die theologische Literatur der frühchristichen Zeit zurück. In der Liturgie wurde dieser Passus aus dem Propheten Isaias (62,11; 63,1-7) bis zur Änderung der Leseordnung (nach dem II. Vatikanischen Konzil) jedes Jahr am Mittwoch der Karwoche gelesen. Diese Lesung ist der Neuordnung, wahrscheinlich wegen ihrer schwierigen Verständlichkeit, zum Opfer gefallen. In der Eigenliturgie des Bistums Trier ist diese Lesung vom Keltertreter jedoch glücklicherweise erhalten geblieben; sie wird heute noch am Festtag der Tunica Christi (Heilig-Rock-Fest), dem alten —Speerfreitagž, dem Freitag nach dem Weißen Sonntag, und in der Oktav dieses Festes gelesen. Zum besseren Verständigung folgt hier der Text aus dem Propheten Isaias (wobei die Übersetzung dem Text der Vulgata folgt). So spricht der Herr und Gott: —Saget der Tochter Zion: Siehe, es kommt dein Erretter. Siehe, sein Lohn ist mit ihm.ž - Wer ist dieser, der von Edom kommt, in roten Kleidern von Bosra, prangend in seinem Gewand, ausschreitend in seiner strotzenden Kraft? - —Ich bin es, der Gerechtigkeit redet und Macht besitzt zu retten.ž - Warum ist rot dein Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? - —Die Kelter habe ich allein getreten, von den Völkern war kein Mann bei mir. Ich trat sie nieder in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm, daß ihr Blut an meine Kleider spritzte und ich mein Gewand besudelte. Denn ein Tag der Rache lag mir im Sinn, und mein Erlösungsjahr war gekommen. Ich schaute aus, doch es fand sich kein Helfer; ich suchte, doch es fand sich kein Beistand. Da half mir mein eigener Arm, und mein Grimm war meine Stütze. So zertrat ich die Völker in meinem Zorn und machte sie taumeln in meinem Grimm. Ich stieß ihre Kraft zu Boden.ž - Die gnädigen Taten des Herrn will ich in Erinnerung rufen, die Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr an uns getan, der Herr unser Gott. Dieser so schwierige wie auch in seiner Bildhaftigkeit eindringliche Text kündet in seinem ursprünglichen Verständnis von einem Strafgericht, das Jahwe an den heidnischen Völkern von Edom und Bosra vollziehen wird. - Die frühen christlichen Autoren jedoch sahen in diesem Bild einen prophetischen Hinweis auf den leidenden Christus. Sie sahen in den vom Gotteszorn Gekelterten Christus, der stellvertretend den Gotteszorn auf sich lenkt. (Alois Thomas hat darüber bereits 1936 geschrieben: Die Darstellung Christi in der Kelter.) - Schon in der Zeit kurz nach dem Jahr 200 finden wir die Deutung dieses Isaiastextes auf die Passion Christi. Es ist der Kirchenschriftsteller Tertullian (Karthago, ca. 160-220), der in Christus den für die Sünden der Menschheit leidenden, —gekeltertenž Gottesohn sieht. Ebenso hat Cyprian von Karthago (+ 258) die Isaiasvision auf Christi Passion gedeutet. Von hier an geht eine breite Tradition dieses Verständnisses bis in die Neuzeit. Die vielen Bilder Christi in der Kelter von der romanischen Zeit bis zu einer neuen Belebung dieses Themas in der Gegenwart zeugt von einer ungebrochenen Tradition, selbst da, wo Exegeten und Liturgiker diese Deutung zurückgedrängt haben. Für das Moselland ist das Kelterbild von Ediger (um 1600) berühmt geworden. Aber auch die Lutherbibel von 1643 zeigt auf ihrem Titelblatt zuoberst das Bild Christi in der Kelter. - So ist es also gerechtfertigt, daß auch heute noch das Bild Christi in der Kelter gerade im eucharistischen Themenkreis, also auch auf einem Kelch, eine Darstellung findet. Egino Weinert hat nun dieses Zusammenhang noch dadurch vertieft, daß er Christus in der Kelter auf der Kuppa des Kelches in den Zusammenhang des Weinstockes gesetzt hat, eine Symbolik, die auf dem Rand der Patene ihre Fortsetzung findet. Das könnte im Stichwortzusammenhang und von der Bildsymbolik wie selbstverständlich erscheinen. Ein Blick in die Rede Christi vom Weinstock (Joh. 15,1-8) zeigt indessen, daß hier doch ein besonderes Thema angesprochen ist. —Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt, bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nicht tun.ž Christus spricht von dem geheimnisvoll-lebendigen Zusammenhang von ihm selbst mit seinen Gläubigen. In diesem Zusammenhang spielt die Eucharistie eine unaufgebbare Rolle. Das mystische Blut Christi und der Geist Gottes beleben in einem geistigen Kreislauf durch die Lebensadern den Weinstock. Wird durch den Weinstock die Kirche als der mystische Christus dargestellt, so finden wir in den Bildern am Fuß des Kelches die Vertreter der —realenž und historischen Kirche. Es geht um die Kirche am Ort, um die Kirche in Trier als eines Teiles der großen weltweiten Kirche. Es sind bestimmte Heiligen dargestellt, die für Trier Bedeutung haben. - Diese Emailbilder passen sich in einer konkaven Biegung dem trompetenförmigen Anstieg des Kelchfußes an. Es sind der Technik nach Zellenschmelze von großer Feinheit, die die ganze Fläche einer jeden Platte bedecken. Die Zellen für die Aufnahme des Schmelzmaterials und auch die Binnenzeichnung sind mit feinen Golddrähten hergestellt. Das Schmelzmaterial weist feine Schattierungen und Changierungen auf. - Beginnen wir auf der Vorderseite mit dem hl. Fürstapostel Petrus! In der Linken hält er das Fischernetz als Zeichen seiner menschengewinnenden Predigt, in der Rechten die Schlüssel, die auf das von Christus verliehene Amt hinweisen. Er ist hier dargestellt als der Patron des Trierer Domes. - Nach rechts schließt sich der hl. Apostel Matthias an. Er nimmt neben Petrus einen wichtigen Platz ein, da sich sein Grab in der Trierer Kirche St. Matthias befindet und er als Patron des Bistums verehrt wird. Zwischen seinen Beinen steht die Axt als das Instrument seines Martyriums; in der linken Armbeuge hält er eine Schriftrolle, mit der rechten Hand hält er die Siegespalme des Märtyrers. - Auf ihn folgt die hl. Kaiserin Helena, mit der Kaiserkrone und in einem goldverziertem Gewand. In ihrer Linken hält sie das von ihr in Jerusalem aufgefundene Kreuz Christi, in der Rechten ein Modell des von ihr und ihrem Sohn Kaiser Konstantin erbauten ersten Domes von Trier. Der Dom hat seit über eintausend Jahren den Titel —Haus der hl. Helenaž. Das Schiff zu ihren Füßen weist auf die weiten Reisen Helenas, bis ins heilige Land, hin. - Der hl. Eucharius folgt als der erste Bischof von Trier. Zwar geht die Christengemeinde wohl schon ins zweite Jahrhundert zurück; aber Eucharius steht als der erste Bischof der hiesigen Kirche vor. Wie ein Wandersmann ist er angekommen, in der Umhangtasche die heiligen Schriften, in den Händen den ihm - wie die Legende sagt - vom hl. Petrus verliehene Stab mit dem Kugelknauf. - In Sankt Maximinus verehrt die Trierer Kirche einen ihrer größten Bischöfe des vierten Jahrhunderts. Auch er führt den Petrusstab, trägt ein Modell des unter ihm weitergebauten Domes. Zu seinen Füßen erscheint in kleiner Figur ein Bischof. Diese Gestalt weist auf den großen Athanasius von Alexandrien hin. Der Metropolit von Ägypten verbrachte einige Jahre seines Exils in Trier als Gast des Maximinus. Man war sich hier in der damals umkämpften Frage nach der wahren Gottheit Jesus Christi einig im Sinne der Rechtgläubigkeit und widersprach den Kaisern. - Im hl. Paulinus, dem Schüler und Nachfolger des Maximinus, verehrt die Trierer Kirche einen Märtyrer der athanasianischen Rechtgläubigkeit. Er unterwarf sich dem Kaiser nicht und mußte dafür im kleinasiatischen Exil sterben. Auch er trägt das Kugelszepter des Petrusstabes, dazu eine Schriftrolle der christlichen Botschaft. - Die Darstellung des hl. Nikolaus mag im ersten Augenblick verwundern. Er ist hier dargestellt als der zweite Patron des Trierer Domes; der Westchor des 11. Jahrhunderts wurde ihm geweiht. Die drei Jungfrauen zu seinen Füßen weisen auf das soziale Engagement und die Mildtätigkeit des Nikolaus hin. Er ist dargestellt in Meßgewändern, mit einer Mitra und einem Bischofsstab. - Zuletzt kommt, nun wieder vor dem hl. Petrus, der hl. Hermann-Josef von Steinfeld. Er ist dargestellt als Mönch. In seiner Linken hält er als Erinnerung an das Apfelwunder in der Kölner Kapitolskirche einen dicken Apfel, dazu ein Buch mit seinen mystischen Schriften. Auf dem Altartisch vor ihm liegt ein offenes Buch und steht ein Kelch, aus dem eine Rose emporwächst; es ist dies die Erinnerung an seine eucharistische Frömmigkeit und das Rosenwunder. Dieser Heilige war auf dem Weg über das Zisterzienserinnenkloster St. Thomas an der Kyll dem Bistum Trier verbunden. Er ist der Namenspatron von Bischof Dr. Hermann-Josef Spital, dem der Kelch dediziert wurde.  Die Patene hat - wie schon oben aus den Maßangaben ersichtlich - einen breiten Rand. Dieser ist auf der Unterseite - in Anspielung auf das Mysterium des Brotes und des Weines - mit stilisierten Trauben und Ähren geschmückt: Goldfäden sind in den dunklen grünen und blauen Emailgrund eingelassen. - Die Oberseite des Randes ist mit farbenfrohen Szenen rundum geziert. Die Mitte nimmt eine kleine Darstellung Christi in der Kelter ein, daneben steht am Himmel eine große rote Sonne. Winzer rechts und links sind mit dem Abernten des Weinberges beschäftigt, geben die Trauben in Bottiche oder tragen die Früchte in Kiepen zu dem großen Bottich, in dem der gekreuzigte Christus als der Keltertreter steht. Sein Blut vermischt sich mit den Trauben. Rechts schließt sich die Szene an, da der Weinbergsbesitzer aus dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt. 20,1-16) die noch Müßigen auf dem Markt für seinen Weinberg verdingt. Diese sitzen auf einer Mauer und warten auf die Arbeit. In dem Torgebäude hat Egino Weinert seine Signatur angebracht: W. Neben weiteren Bildern der Arbeit kommt schließlich die Ausgabe des Lohnes für die Tagesarbeit. Der Hausvater, der wegen der Auszeichnung durch einen Nimbus die Züge des göttlichen Richters annimmt, teilt den —gerechtenž Lohn aus: einem jeden einen Denar. Das Ganze von Kelch und Patene stellt sowohl ein Ensemble von zentralen liturgischen Geräten dar, als auch eine theologisch-ikonologische Aussage zur Bedeutung der Eucharistie. Die Szenen und Inschriften beziehen sich auf das Geschehen, dem der eucharistische Kelch und die Patene im sakramentalen Geschehen dienen sollen. Es geht um die Feier der heiligen Eucharistie, des Altarsakramentes, des Mysteriums des Neuen Bundes. Daß Kelch und Patene die vornehmsten der Vasa Sacra sind, bedarf eigentlich keines besonderen Hinweises; denn sie enthalten das Brot und den Wein, welche in der Konsekration unter den Worten Jesu aus dem Abendmahlsaal in seinen heiligen Leib und sein heiliges Blut verwandelt werden. Es geht also um die heilige Gegenwart Christi unter den bescheidenen Gestalten von Brot und Wein. Da das Mysterium von Leib und Blut Christi untrennbar mit dem Paschamysterium, dem Kreuzestod Christi und seiner Auferstehung, zusammenhängt, ist auch in der Feier des heiligen Gedächtnismahles sein Kreuzesopfer auf sakramental-geheimnisvolle Weise gegenwärtig. Diese Aussagen aus der katholischen Sakramentenlehre muß man bedenken, will man die Zeichen und Szenen auf den beiden Gefäßen verstehen und in ein Ganzes einordnen. Da die Feier der heiligen Mysterien aber in der konkreten Ortskirche erfolgt, stellt sich auch diese mit ihren Heiligen vor. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg öffnet schließlich den Blick des Glaubens in die eschatologische Weite, da in der verhüllten Sprache des Gleichnisses Lohn und Gericht in den Blick kommen. Bereits die Arbeit des Aberntens der Weinstöcke möchte daran erinnern, daß in der Apokalypse (14,14-20) die Vorbereitung des Weltgerichtes unter jenem eindrucksvollen Bilde geschildert wird, da der Engel die Sichel anlegt, um den Weinstock der Erde abzuernten. Dann allerdings werden die Trauben in die Zornkelter Gottes geworfen. FRAU PROF. TRESKO ZUR CHORMANTELSCHLIESSE GRANULATION AUF SILBER —VERKÜNDIGUNGž Silbergranulation kennzeichnet Heiligenscheine, Mantelumhänge und Säume. Etwas erregendes hat diese Arbeit... Man spürt noch etwas von der Überraschung und dem großen Wunder, das plötzlich geschieht, als der Engel der Verkündigung in seiner himmlischen Gewalt in das Gemach der —Magd Mariaž tritt um ihr die Botschaft von der Geburt des Heilands zu verkünden. Diese Pluvialschließe von Egino Weinert ist zweifellos eine der ausdrucksvollsten und stärksten Arbeiten kirchlicher Goldschmiedekunst unserer Zeit, deren Kühnheit die Originalität wirklichen Künstlertums beweist.  WERKE IM LAUFE DER ZEIT (Autorenauswahl) DAS BRONZEPORTAL IN ST. MICHAEL, SOLINGEN —DAS HIMMLISCHE JERUSALEMž Betrachtungen über dieses Thema anzuregen, ist die grundlegende Idee bei der Gestaltung des Portals von der Kirche St. Michael, Solingen (1979). Der Herrscher der Welt, dargestellt mit der Hl. Schrift in der Hand, seitlich von ihm die Symbole der Evangelisten, thront inmitten seiner Heiligen, mit den Füßen ruhend auf dem Weinstock über den Türflügeln. Alle Menschen sollen eingereiht werden in die große Schar der Erwählten. Acht Bildtafeln darunter werden kraftvoll, bogenförmig ornamentativ umrangt von den Weinreben mit den reif gewordenen Trauben. Auf den Lebensabschnitten in den Bildtafeln ist das Heilsgeschehen zusammengefasst: Die Verkündigung, die Szene im Stall mit den drei Weisen aus dem Morgenland, der lehrende junge Jesus inmitten der Schriftgelehrten vor einem Fass voll Schriftrollen sitzend, gerade von seinen Eltern entdeckt, dann die Taufe im Jordan durch Johannes, die Brotvermehrung, das Abendmahl vor seinem Tod am Kreuz, die weinenden Frauen unter dem Kreuz und Jesus Christus, der aus dem Grab Auferstandene. DAS BRUSTKREUZ VON ABT FIDELIS In dem graugrundigen Emaillekreuz hebt sich deutlich die Gestalt Jesu ab, gezeichnet mit den Wunden; darüber in halber Höhe in griechischen Buchstaben das Wort Agape (Liebe), liebendes Verzeihen, was in der Urkirche auch gemeinsames Mahl, Teil des Abendmahls, bedeutete. Auf der Rückseite sieht man die aus römischem Adel stammende Martyrerin Felicitas, Patronin des Klosters, Witwe und Mutter von sieben Söhnen. Vor ihren Augen nahmen sie nacheinander den Tod auf sich, um Christus mit einem Opfer für die erzürnten Götter nicht verraten zu müssen. Unter der heidnischen Priesterschaft von Kaiser Marc Aurel wurde 162 n. Ch. Felicitas auch hingerichtet. DAS TAUFBECKEN DER KIRCHE ST. KOLUMBAN IN BREGENZ Das bronzene runde Taufbecken der Christ-Königs-Kirche steht auf drei Pfeilern. Der Beckenrand ist verziert mit in Halbrelief modellierten Szenen aus dem Leben Jesu. Im Griff des Taufbeckendeckels sind dargestellt Johannes,der im Jordanwasser steht und Jesus tauft. DIE FENSTER DER CHRISTKÖNIGSKIRCHE IN ANSBACH Die Christ-Königs-Kirche in Ansbach ist als Oktogon gebaut. Sie erhebt sich über lichtdurchflutete Seitenwände in eine monumentalen Krone. Zahlreiche der weit über tausend Fenster (450) sind von Egino G. Weinert ornamental geschmückt oder mit Motiven aus dem Alten Testament gestaltet, die auf die späteren Geschehnisse im Neuen Testament im Wirken Jesu hindeuten. Die Kindheitsgeschichte Jesu wird geschildert, seine Lehr- und Wundertätigkeit, die Passionsgeschichte, Ostern... Ein Glasbilderbuch. DIE PAXTAFEL Die Paxtafel wurde während der Messe zum Friedenskuss vor der Kommunion gereicht. Sie ist zwei handbreit groß in Metall getrieben mit aufgelöteten Emaillebildern und einem geschwungenen rückwärtigen Griff versehen. In der Mitte der Kristall, eine Rauchquarz, stellt Jesus dar, umgeben von den Zwölf Aposteln. Siehe Seite ....(in Egino G. Weinert Goldschmied, Maler und Bildhauer Erinnerungen, Gespräche, Reflexionen  Egino G. Weinert ist eine überragende Gestalt der Zeitgeschichte, über die es möglichst wahrheitsgetreu zu berichten gilt. Seine Gedanken und Erzählungen sind eine Fülle von Impressionen, hingetupft wie ein bunter Blumenmeer. Mit diesem aus vielen persönlichen Gesprächen entstandenen Buch versuche ich, ein Porträt des Künstlers Egino G. Weinert zu zeichnen. Sein faszinierendes Leben und sein Werk sind bestimmt worden durch das Elternhaus, das Leben in einem Benediktinerkloster, die Härte des Krieges und die Zeiten der Armut, durch seine Schaffensfreude und seinen lebendigen Glauben sowie durch Begegnungen ganz eigener Art mit namhaften Künstlern und großen Persönlichkeiten wie Papst Paul VI und Papst Johannes Paul II. Mein Weg führte mich Anfang der fünfziger Jahre in Bonn fast täglich an seinem Kelleratelier auf der Kronprinzenstraße vorbei. Angezogen von außergewöhnlichen Ausstellungsstücken hinter dem kleinen Kellerfenster - Kelche, Monstranzen und Schmuck - fasste ich eines Tages den Mut und klinkte die Türe auf. Im Halbdunkel kam mir in dem feuchten Kelleratelier ein großer Mann entgegen, der sich durch das wirre dunkle Haar strich, und ich entdeckte, dass ihm die rechte Hand fehlte: Egino G. Weinert. Schon damals umgaben ihn seine Werke in drängender Fülle. Die neue, schlichte, strenge Art der Gestaltung seiner Werke erinnerte mich an Leuchter, die ich auf den Seitenaltären der Benediktinerabtei in Münsterschwarzach kurz zuvor gesehen hatte. —Daran habe ich mitgearbeitetž, erfuhr ich von dem Künstler, —denn Sie müssen wissen, ich war da fünfzehn Jahre lang Klosterbruder, eine wunderbare Zeit - bis 1949, aber das ist eine lange Geschichte ...ž Davon will ich erzählen und aus dem überfließenden Reichtum seines Lebens berichten. Egino G. Weinert ist eine faszinierende Persönlichkeit, die wir, mein Mann und ich, zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Waltraud auf Reisen und Stationen seines Schaffens begleiten durften. Mit ihm sind wir nach Portugal zur Einrichtung einer Karmeliterinnenkirche in Aveiro gereist, nach Fatima zur Einrichtung der ungarischen Stephanuskapelle, nach Galeazza (Italien) und nach Denia (Spanien). In Sommernächten auf der Terrasse seines Hauses in Denia bannten und begeisterten uns seine bunt schillernden Erzählungen über Ereignisse, die ihn begeisterten oder kränkten und Erlebnisse, die ihn formten. Mein Mann las Lebensgeschichten Heiliger und Geschichten aus der Bibel vor, spontan unterbrochen durch gehaltvolle Anmerkungen und Diskussionen. Wir sahen dabei zu, wie unter der künstlerischen Hand aus einer dünnen Schicht Plastilin auf einem Holzuntergrund, halbplastische, lebendige, ausdruckstarke Figuren erwuchsen. Die nächtelangen Gespräche erschlossen uns Facetten und Phasen aus dem Leben Egino G. Weinerts, in denen sich seine Liebe zu Gott immer wieder neu spiegelte. Von den aufgezeichneten Gesprächen sind Passagen möglichst in ihrer Originalität belassen worden, um dem Typischen und Besonderen der Persönlichkleit von Egino G. Weinert Raum zu geben. Das —Gž in Egino Weinerts Namen wurde später zugefügt, da einer seiner Söhne, der ebenfalls künstlerisch tätig ist, auch den Namen Egino Weinert trägt. EGINO G. WEINERT ist ein weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Goldschmied, Maler und Bildhauer. Sein Atelier befindet sich im Schatten der Domtürme auf der Marcellenstr. 42 in Köln. Schon beim Eintritt überrascht die Fülle der ungewöhnlich gestalteten sakralen Gegenstände des früheren Benediktinerbruders: handvergoldete Kelche mit biblischen Darstellungen, vielfältig nach eigenwilligen Entwürfen geformt; Madonnen, Skulpturen und Heiligengestalten auf oft nur handtellergroßen Emaille- oder Bronzebildern, Schreine und Tabernakel, daneben außergewöhnlicher, ansprechender Schmuck. Durch den schmalen Verkaufsraum, vorbei an Werken, die in Vitrinen und Fächern keinen Platz mehr finden, führt der Gang in die Werkstatt, in der seine Mitarbeiter wirken. Der Verlust der rechten Hand, den er im Alter von fünfundzwanzig Jahren erlitt, zwang ihn, besondere Techniken zu entwickeln. Die Werke von Egino G. Weinert tragen seine unverwechselbare Handschrift. Sie erhielten ihre Formen durch die offene, kompromißlose Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschick, durch Begegnungen mit Künstlern, das Studium ihrer Werke und den Besuch der Werkschule in Köln. Seine geistigen Impulse und seine vielseitige Ausbildung verdankt er dem Benediktinerkloster Münsterschwarzach, das er 1949 verlassen mußte, vor allem wohl deshalb, weil er mit seiner modernen, gegenständlichen Kunstrichtung der damaligen Kunstauffassung der Verantwortlichen des Klosters nicht entsprach, die den Beuroner Stil pflegten. Er gestaltete plastische Bilder aus dem Alten und Neuen Testament, eingefaßt in ausdrucksvolle, das Thema unterstreichende Ornamentik. Egino G. Weinerts Kirchenportale, Altäre, Kreuzwegstationen, Kanzeln, Taufbecken, Leuchter, Tabernakel, Ambonen finden sich an vielen Orten der Erde, in Amerika, Skandinavien, Brasilien, Dänemark, England, Italien, Portugal, Spanien, Tschechien, Schweiz, Belgien, Japan, Korea und Israel. Mit der linken Hand schafft er die feinsten Biegearbeiten. In seinen emaillierten Werken, Bildern und seinem Schmuck verwendet er eine künstlerische Technik, die meisterhaft von ihm beherrscht wird. Seine Darstellungen sind kraftvoll, glutvoll, allen verständlich. Er sagt: —Ich fühle mich wie ein Kind, das zu Füßen Gottes spielt.ž Schon weit über tausend Heiligengestalten, deren Lebensgeschichten er einzeln studierte, hat Egino G. Weinert in seinen Bronze- und Emaillebildern wieder zu neuem Leben erweckt: —Sie alle waren Menschen, die Großartiges geleistet haben.ž Er bleibt in allem der benediktinischen Auffassung treu, den Gewinn aus seiner Arbeit so gering wie möglich zu halten. Diese Einstellung half ihm nach harten Hunger- und Betteljahren zu unvergleichlichem Erfolg. Sein Bestreben ist es, auch dem Ärmsten seine Kunst erwerb- und erlebbar zu machen. So wirkt er wie ein Missionar, der versucht, in allem Gott, dem Schöpfer aller Dinge, und den Menschen zu dienen. KINDHEIT DURCH DAS LOCH IM FRIEDHOFSZAUN Der Künstler erzählt: Geboren wurde ich am 3. März 1920 als Ältestes von fünf Kindern in Berlin Schöneberg, Hauptstraße - Ecke Martin-Luther-Straße. Getauft wurde ich auf den Namen Günther Franz Stanislaus Przybylski in der katholischen Norbertkirche gegenüber dem prachtvollen Schöneberger Rathaus über dem Taufbrunnen, der von der evangelischen Königin Luise von Preußen gestiftet worden war. Als nach den vier Jungen ein Mädchen, Marianne, 1930 das Licht der Welt erblickte, so erinnere ich mich, wurden wir Jungen losgeschickt, eine Schwester des Brigidenordens zur Hilfe für unsere Mutter zu erbitten. Sie kam täglich, durfte kein Essen annehmen und half bescheiden. Ich erinnere mich noch an viele Einzelheiten aus meiner Kinderzeit in Berlin. Als Kind sollte ich einen großen Strauß Margeriten dem ersten Nuntius des Vatikans Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., in einem Sportstadion überreichen und ein Gedicht aufsagen. Trotz der Bemühungen einer Souffleuse brachte ich nichts heraus. Ich war viel zu aufgeregt. Um den Weg zur Kirche abzukürzen, schlüpften wir Kinder durch ein Loch im Friedhofszaun; so sparten wir eine Viertelstunde Weges. Wir spielten auf dem Friedhof, —wetztenž über die Gräber. Das war romantischer als auf der Straße. Meine ganze Jugend spielte sich vor der Kirche St. Fidelis ab. Hinter dem Friedhof befanden sich die —Raunschen Bergež, wo von der Ufa Filme gedreht wurden wie —Stürme über dem Mont Blancž, —Weiße Reiter in Schwarz-Weiß-Afrikaž; für uns Kinder war es etwas Besonderes, Filmschauspieler zu sehen, Autogramme zu jagen. Wenn irgendwo etwas ausgeheckt worden war, fiel der Verdacht natürlich immer zuerst auf uns Jungen. MEINE ERSTEN KONTAKTE MIT DER KUNST Schon als Achtjähriger konnte ich an der Eröffnung einer Kunstausstellung im Schöneberger Rathaus teilnehmen, die mein Vater als Angestellter betreute. Eine Tante, eine Graphikerin, förderte mein Zeichentalent und machte mich mit Künstlern bekannt. Außer mit unserem Nachbarn Emil Nolde und mit Max Pechstein, die in unserem Elternhaus ein- und ausgingen, kam ich mit Otto Müller, Georg Grosz und Otto Dix in Berührung. Max Liebermann, ein vornehmer Maler, - selbst Hindenburg mußte sich bei ihm vorher anmelden lassen -, Präsident der Secession, führender Meister des deutschen Impressionismus, beurteilte Noldes ausgestellte Gemälde als —Schmierereien, aber malen kann er.ž Der Vater von Liebermann war Bankdirektor und wohnte im ersten Haus links gleich hinter dem Brandenburger Tor. Wenn Ausstellungen im Schöneberger Rathaus geplant waren, mußte Max Liebermann erst die Genehmigung geben. Wenn Vater bei ihm vorsprach, musste ich draußen warten. Mein Vater stellte den Malern unsere Kellerräume als Atelier zur Verfügung. Wenn alle gegangen waren, schlich ich mich in den Keller, um mir die Bilder anzusehen. Ich dachte mir damals: —Was die in so hinreißenden Farben unfromm malen, male ich jetzt anders in genauso schönen Farben .ž Meine ersten Herz-Jesu-Bilder entstanden. Ich zeigte Emil Nolde die Bilder, der war entsetzt: —Junge, laß die Finger von diesen frommen Sachen, male lieber die Hühner in eurem Hühnerstall.ž Damals entdeckte ich eine Zeitschrift namens —Michaelž, eine Jugendzeitschrift aus dem Herderverlag, mit Scherenschnitten von Frau Boissereé, von Anna Nagel und Andachtsbilder von Ruth Schaumann. Aber auch diese Bilder entsetzten Nolde. Außerdem stieß ich hier auf Werke von Kampendonk, Windelschmidt, Barlach, Ewald Mataré, Thorn Prickler, Professor Walter Mellmann und Max Pechstein, der inzwischen nach Amerika ausgewandert war. Ich habe immer gemalt. Glaubensverkündigung erfuhr ich durch Bilder im Wartezimmer oder im Friedrich-Wilhelm-Museum. El Greco missfiel mir: —Nein,ž sagte ich mir, —so lange Figuren machst du nicht.ž  FRÜHE IMPRESSIONEN Als Junge schon zog ich mit zwei Freunden los um zu zeichnen, zu malen und zu schwätzen. Auf die grüblerische Frage, ob es Gott wirklich gibt, fanden wir die Antwort: —Naja, gibt es Ihn, so haben wir auf das Richtige gesetzt, wenn nicht, wäre es der schönste Traum von der Schöpfung her.ž Richtig habe ich Gott erst durch Jesus kennengelernt. Zusammen mit meinem Bruder Werner, der später in Stalingrad gefallen ist, feierte ich als Neunjähriger, die Erste Heilige Kommunion. Sie war für mich etwas Besonderes: Ein großes einschneidendes Erlebnis, das mein ganzes Leben bestimmte. An meiner Firmung später störte mich die unpersönliche, nüchterne Art der Spendung. Eine Lehrerin war Patin von - so schien es mir - zweitausend Kindern. Das ärgert mich bis heute, dass unsere Lehrer uns nicht die grundlegende Bedeutung der Firmung überbrachten. Wir waren so viele Kinder und mussten lange warten, bis wir in die Kirche durften. Es kam mir vor wie eine Massenabfertigung. Das war noch vor Hitler. Es hieß, die Familien hätten keinen Sinn für die Firmung. Deshalb gestaltete ich Jahre später ein Firmungskreuz: jedem Kind sollte man das Kreuz umhängen, das auf Christus hinweist und auf den Heiligen Geist. Unser Pfarrer Pater Ratte, ein Hiltruper Missionar vom Heiligsten Herzen Jesu in Berlin an der St. Fideliskirche, kämpfte gegen die Nazis. Als Messdiener engagierte ich mich für die Kirche. Für den Ordensbruder Hoppe trug ich dreizehnjährig die Kirchenzeitung aus, für unseren Pfarrer riss ich Nazi- und Kommunistenzettel von den Litfaßsäulen ab, um sie ihm stoßweise zum Einstampfen zu bringen. Es gab zu der Zeit eine Menge Arbeitslose, an jeder Ecke standen sie. Hitler machte von sich reden, und man hoffte 1933, der Mann würde Deutschland von der Arbeitslosigkeit befreien. Denn was der damalige Reichskanzler Brüning gemacht hatte und die anderen Politiker in der Weimarer Republik, wurde uns als lächerlich hingestellt. Es kam der Röhmputsch. Aber wir konnten das Geschehen um uns noch nicht begreifen, auch nicht den Tod von Dr. Erich Klausener. Er war der Leiter der —Katholischen Aktionž gewesen. Am 30. Juni 1934 wurde er in seinem Büro von Nationalsozialisten erschossen. B(runo): —Der, der ihn mit erschossen hat, ist zu acht Jahren verurteilt worden. Seine Sekretärin erzählte, SS-Leute, darunter ein Hauptsturmführer, und ein Gestapo-Kommissar stürmten in sein Zimmer, schossen auf ihn, stellten sich vor die Türe, warteten bis er verblutet war und machten sich auf und davon. Meiner Meinung nach war der Anlass zur Ermordung die Rede, die er am Katholikentag in Berlin-Hoppegarten gehalten hat. Er war wegen seiner Gradlinigkeit den Machthabern des Dritten Reiches seit langem verhasst. Er hatte sogar nach der Rede das Lied —Fest soll mein Taufbund immer stehenž laut angefangen zu singen, in das die versammelte Menge einfiel.ž E(gino) G. W(einert): —Als Messdiener war ich bei seiner Beerdigung dabei. Er wurde auf unserem Friedhof an der 1. Station des Kreuzwegs —Unschuldig zum Tode verurteiltž beigesetzt. Kein Grabstein durfte aufgestellt werden. Ich hatte noch die Kirchenzeitung ausgetragen, in der sein Tod mitgeteilt wurde. Seine willkürliche Erschießung wurde darin totgeschwiegen. Die Urne mit seiner Asche ist jetzt in der 1963 erbauten Kirche —Maria Regina Martyrumž in Berlin-Charlottenburg beigesetzt, einem Ort zur Erinnerung an den Tod der Widerstandskämpfer des 3. Reichs.ž  MEIN VATER Er war ein Deutschnationaler, ein Kaisertreuer. Obwohl er kein Abitur hatte, brachte er es zum Stadtrat. Er hatte im Ersten Weltkrieg als Sanitäter bei den Kämpfen an der Somme in Frankreich ein Bein verloren und konnte so seinem geliebten Beruf als Schafzuchtmeister nicht mehr nachgehen. Vater war ein akkurater, vornehmer Mann: sauberer Anzug, pflichtgetreu, Eisernes Kreuz, Haltung! Für ihn war es eine Ehre, Soldat zu sein. Wir durften nicht beim Essen schlürfen, nicht berlinern. Er war mir so lieb - ich hätt' ihn immer —knutschenž können. Er war aber auch ein —komischer Heiligerž. Er war Nazi und Blockwart, führte uns aber sonntags immer nach Schöneberg zur Kirche. Während der Messe saß ich ungern auf seinem harten Holzbein. Sein vom Beten zerfleddertes Gebetbuch halte ich noch heute in Ehren. Eines Tages hatte er mich als 9-jährigen in das Jungvolk der Hitlerjugend gesteckt. Pfarrer Ratte tobte. Aber es gab keine Jugendgruppe für mich. Es existierte wohl die Deutsche Jugendkraft DJK und —Neu-Deutschlandž der Jesuiten, das aber nur für Gymnasiasten zugängig war. Daraufhin gründete unser Pfarrer Ratte eine Art Kolpinggruppe, die aber nur inoffiziell existieren durfte. Auch gab es sonst zu dieser Zeit keine gemischten Gruppen mit Jungen und Mädchen. Wir nannten unseren Seelsorger nur Pfarrer Maus. Unser Pfarrer hat Hitler in jeder Predigt —durch den Kakao gezogenž, aber ganz vorsichtig! Der Pfarrer sagte eines Tages zu unserem Vater: —Sie haben fünf Kinder, vier von ihnen stehen als Messdiener am Altar. Sie kommen mir nicht mehr mit der Uniform in die Kirchež. Darauf mein Vater: —Dann komme ich nicht mehr zu Ihnen beichten.ž Er sympathisierte eine zeitlang mit den Freimaurern. Der Tod seines zweiten Sohnes im Krieg hat ihn aber wieder gewandelt. Ich habe nur einmal von meinem Vater Prügel bezogen, weil ich zuhause ein Jahr lang angab, meine Hausaufgaben bereits in der Schule gemacht zu haben. Ab da musste ich immer wieder einen Aufsatz als Strafarbeit vorlegen, den ich säuberlich auf Pergamentpapier malte oder in Buchform band. Jetzt konnte ich ihnen zeigen, wo meine Stärke, Kraft und Lust lag. Kinderwagen schieben, staubputzen, jeden Tag Klavier spielen, das war nicht meine Sache. Ich war ein Träumer, aber auch aktiv, vor allem musisch. Alle Museen zogen mich an. Mit meinen Bildern war ich der Beste in meiner Klasse. Viele Scheren- und Linolschnitte aus dieser Zeit wurden weggeworfen, was mich später dazu veranlasste, Unzerbrechliches zu schaffen. Auch Romano Guardini lernte ich als Messdiener und in Gesprächskreisen kennen. Er begeisterte mich. Vater erwarb 1931 in Blankenfelde bei Rangsdorf ein Grundstück von einem halben Morgen, wo er eine Wohnlaube errichtete, unsere Residenz. Die Eltern schliefen in gedrechselten Holzbetten, wir auf Schlafsäcken, die tagsüber unter den Betten verschwanden. Auch hatte der naturliebende Vater in der Laubenkolonie in Friedenau zusätzlich eine Parzelle gepachtet. Ein anderes Urlaubsziel war Rove an der Ostsee, wo wir bei einem Bauern und Fischer wohnten. An den mecklenburgischen Seen konnte ich meiner Angelleidenschaft nachgehen wie an den Berliner Wassern, vor allem dem Plötzensee. Öfter hatte ich einen Fisch an der Angel neben dem fahrenden Boot wie auch später in Denia in Spanien, der über dem Malen vergessen, schon von einem größeren Fisch gefressen worden war. Hier an der Ostsee entdeckte ich in den Dünen unter einem aufgespannten Sonnenschirm den Maler Max Pechstein. Zu diesem robbte ich mich mit einem Regenschirm und meinem Malzeug. Unser Wohnsitz wechselte öfter. Wir zogen in das Viertel der Kriegsversehrten auf die Röblingstraße 15 und später auf die Domnauerstraße 29. Dieses Haus sollte nach fünfundzwanzig Jahren Mietzahlung Eigentum werden. Hier hatte der Vater ein Haus mit Stall, Hühnern und einer Ziege. Es lag an der Opelversuchsstrecke. Auf der Avus-Rennstrecke wurde der Raketenantrieb ausprobiert. Ich lag auf der Wiese und träumte, mit einem Strick die Ziege am Bauch festgebunden, bis ich um vierzehn Uhr den Vater abholen mußte. Er baute mit mir Drachen, die wir steigen ließen. An der Schnur befestigte ich einmal einen Briefgruß —an den lieben Gottž. Die Gärten meines Vaters waren immer ein Blumenmeer. Als ich meine Eltern später nach Spanien holte, überreichte Vater meiner Mutter jeden Morgen eine Rose. Ich liebe von Jugend an Gärten, den Kirschbaum, meine Erdbeeren, meine Radieschen. Ich hatte immer das Bedürfnis, zu sagen: —Das gehört mirž, wofür mein Vater vollstes Verständnis hatte.  MEINE MUTTER BERTA war das Jüngste von achtzehn Kindern. Meine Großmutter mütterlicherseits hatte mit ihrem ersten Mann, einem Müller, 15 Kinder, der sich aber, nach einer missglückten Bürgschaft arm geworden, an der Backofentüre erhängte. Danach heiratete die Großmutter den Gesellen ihres zuvor verstorbenen Ehemannes, der bald 18 Kinder zu versorgen hatte. Ein dynamischer Mann, mein Großvater, mit viel kaufmännischem Geschick. Er erwarb Bauernhöfe, 16 Pferde und ein Fuhrunternehmen, Gaststätten, ein großes Hotel, eine Bäckerei, eine Motorradfabrik, ein Beerdigungsinstitut und eine Straßenbaufirma und ging leidenschaftlich auf die Jagd. Meine Großmutter, eine fromme, tüchtige Frau, sah ihre vielen Kinder als Gottes Gabe und nahm sie dankbar an, was er immer anerkannte. Nach dem Ersten Weltkrieg, während der Inflation, hat mein Großvater vieles verkauft und wollte mit dem Geld seine Existenz sichern. Meine Mutter, das achtzehnte Kind, war eine strenge und fromme Frau. Ich wüßte nicht, dass sie einmal das Tischgebet vergessen oder mit uns morgens oder abends nicht gebetet hätte. Nach dem Tode ihres Vaters zog sie nach Berlin und leitete die Pension einer Frau Kirst. Ihre Kochkünste und die Kenntnis zur Führung eines Hotelbetriebes hatte sie im Hotel ihres Vaters erworben. Sie war zum Katholizismus konvertiert aus Überzeugung unter Mithilfe des jungen Grafen Spee, mit dem sie freundschaftlich verbunden war. Er fiel im Ersten Weltkrieg in der Nordsee bei der Schlacht im Skagerrak. Mein Vater, Franz Stanislaus Przybylski, den meine Mutter Berta, geborene Klopsch, 1919 in der Mathiaskirche in Berlin heiratete, nahm den Namen —Weinertž für seine Familie in den Anfängen der Nazizeit an, weil er deutsch klang und besser zu buchstabieren war. Zu dieser Zeit änderten viele in Deutschland ihre ausländisch klingenden Namen. Auf der Tempelhofer Chaussee war einmal in der Woche Markt. Er war aber für meine Mutter mit der Kiepe auf dem Rücken weit weg. Wir mußten vorbei an der Laubenkolonie, der Zeppelinfabrik, vorbei an Schwarzkopf, der Fabrik für Parfümerie und Haarpflege, deren Müllecke für mich Anziehungspunkt war nach dem Kirchgang. Herrliche Flaschen und Dosen kramte ich da aus. Als die St. Fideliskirche in der Nähe auf dem St.Mathiasfriedhof gebaut wurde, entfiel der kilometerweite Marsch zur Herz-Jesu-Kirche am Tempelhof. Jeden Tag bekam Mutter 5 Mark für den Haushalt. Ein Ei kostete 10-12 Pfennige, drei Brötchen 10 Pfennige, ein Pfund Kirschen 12 Pfennig, Pflaumen auf dem Markt 15 Pfennig, die Butter 1 Mark. Aber als Adolf Hitler an die Macht kam, stieg der Preis der Butter gleich auf 1,80 Mark, damit die Bauern besser verdienen sollten. Unser Keller war voll mit Eingemachtem. Um ein Zimmer einen Tag lang zu heizen, brauchte Mutter drei Briketts. Um zwanzig Uhr wurde der Ofen zugedreht, so glimmte die Glut bis zum Morgen. Ein Zentner Briketts kostete 90 Pfennige. So kam Mutter mit 20 Mark für das Heizen im Winter aus. Sorgsam hob sie auch die Pferdeäpfel von der Straße auf für Vaters Rosen und Kakteen. Meine Mutter hat so manchen Stock über meinem Rücken zerbrochen. Später entschuldigte sich die zarte Frau herzlich: —Du hast die Prügel für deine vier Geschwister als Ältester mitübernehmen müssen.ž Aber ich war mit meinen Eltern zeitlebens herzlich verbunden. Ich schrieb ihnen alle vierzehn Tage einen Brief. Viel später holte ich sie zu mir nach Denia, an die Ostküste von Spanien, und richtete ihnen ein kleines Haus gegenüber von meinem ein. Es lag einsam hoch oben am Hang mit Blick auf die Stadt und das weite Meer. Der Bürgermeister kam mit anderen Ortsbewohnern fast täglich aus der Stadt in der Sonnenglut den Berg hinaufgepilgert zu einer Tasse Kaffee bei meiner Mutter. —Und obwohl sie die Sprache nicht kannte, gab es viel zu lachen und herrlich zu schmausenž. So schwärmte der Bürgermeister noch lange Zeit später. Heute, wo ich selbst ein Krüppel bin, verstehe ich, dass ich Vaters Wunsch, einen Eselskarren für die Fahrt in die damals kleine Stadt zu besitzen, nicht genug Bedeutung beimaß. Als die Eltern im hohen Alter starben, dachte ich, dass ich ihren Verlust nie verwinden könne.  FERIEN BEIM GROSSVATER Mein Großvater väterlicherseits, der aus einer alten Schafzüchterfamilie stammte, war mit seinen elf Kindern nicht ganz so kinderreich wie die Großeltern meiner Mutter. Die Kinder wuchsen auf zwischen Schafen und in Gottesfurcht. Er hat nie verstehen können, dass seine Kinder in die Stadt abwanderten. Diese Freude, alles wachsen und gedeihen zu sehen, zu bedenken, dass alles ein Geschenk Gottes ist, hat er immer wieder seinen Kindern gepredigt. Als ein Sohn ihm einmal Essen bringen wollte, sah er seinen Vater inmitten der Herde knien, betend mit erhobenen Armen. Wenn er seine Hunderte von Schafen vorantrieb, griff er zur Flöte. In den Ruhezeiten strickte er. Die großen Schulferien verbrachten wir auf seinem Bauernhof, genannt —die Schmachtž. Eine Kutsche holte uns vom Bahnhof ab. Bevor mein Großvater starb, überreichte er mir viel zu große Handschuhe. Auf mein Erstaunen hin antwortete er: —Die sind nicht für Kinder gemacht, das sind Handschuhe, wenn du einmal groß bist.ž Meine Großmutter spann die Wolle mit den Mägden. Die Wolle wurde abgeliefert als Beitrag zur Pacht der großen Güter. Die lehmigen Straßen säumten Obstalleen, die zum Hofe führten. Die Pflaumen wurden schon in der Blütezeit versteigert. Die Bezahlung richtete sich nach dem zu erwartenden Ertrag. Man wartete möglichst die Eisheiligen ab, danach waren bessere Preise zu erzielen. Vater hat die Früchte in Körben zur Versteigerung gebracht, den Rest fauler Früchte vergoren. Im Herbst stellte er die Fässer auf die Straße und schwefelte sie. Das stank wie die Pest. Die Knechte bekamen im Monat zwanzig Mark und Verpflegung. Es gab Ziegen- und Schaffleisch und Eier in Hülle und Fülle, denn es war ein großer Hof mit mehr als tausend Schafen, mit Hühnern, Gänsen und Kühen. In der Mitte der Scheune, auf der Tenne, hing ein dampfender Kessel über dem offenen Feuer, aus dem die Großmutter immer heißes Wasser für den Kaffee schöpfte; daneben stand ein langer Tisch, um den sich alle versammelten. Wenn wir da waren, kochte Mutter. Erst wenn Großvater das Besteck in die Hand nahm, durften auch die anderen mit dem Essen beginnen. Sie mußten aufhören, wenn er seine Gabel abgelegt hatte. Bei Familientreffen wurden die neuen Frauen vorgestellt und darauf geachtet, ob sie auch fromm genug waren. Die Kutsche brauchte am Sonntag fast eine Stunde durch den Hohlweg hinauf zur Kirche. Wir Kinder stiegen unterwegs aus und sammelten Wald- und Himbeeren in einer Milchkanne. Vor der Kirche mußten wir warten und die Pferde mit dem Futtersack beobachten. Der Hofhund, ein Bernhardiner, begleitete mich beim Erdbeerenpflücken. An einer Schneise wuchsen sie rechts und links. In kürzester Zeit füllte sich meine Zweiliter-Milchkanne. Auch Pilze und vor allem Pfifferlinge gab es in Hülle und Fülle - die Wälder schienen gelb von Pfifferlingen zu sein. Einmal erzählte mir Großmutter eine Begebenheit. Großvater spielte unentwegt im Hof auf seiner Flöte. Großmutter bat ihn, er solle doch aufhören, damit er die Kinder nicht aufwecke. Er aber spielte und spielte. Da entriß sie ihm die Flöte und zerhackte sie vor seinen Augen. Tja, das war eben meine Großmutter väterlicherseits, eine resolute Frau. Unsere Familie läßt sich weit zurückverfolgen bis ins 16. Jahrhundert. Ein Urahn, Bürgermeister in Bamberg, soll als Schafzüchter nach Polen gezogen sein, um dem Einfluß der Hugenotten zu entfliehen. Sie wanderten von der Ukraine bis Rügen und stellten auf dem Wege ihre Zuchtschafe den Schafen der Bauern zur Verfügung. Einer meiner Vorfahren hat bei der Überwinterung seiner Schafherde an der Ostsee auf Rügen alle Tiere bei einer großen Sturmflut verloren, als 1872 die Insel Fehmarn sich vom Festland löste. Um sich neue Zuchttiere zu beschaffen, fuhr er nach London. Zur Führung eines Herdbuches musste man ein Wappen vorweisen. England war schon immer vorbildlich in der staatlichen Registrierung von Zuchtvereinen. Um mit einer kleinen Herde den Lebensunterhalt bestreiten zu können, verdingte er sich später bei einem Grafen in Posen als Rittmeister und baute mit dessen Hilfe einen Bauernhof mit großen Stallungen in Betsche. Mein Vater hatte uns immer erklärt, es existiere ein Wappen derer von Przybylski - das heißt Ankömmling -, ein schwarzer Bock mit einer goldenen Krone und roter Zunge auf weißem Feld, worüber wir uns amüsierten. Als ich später aber in London die Nuntiatur von Erzbischof Dr. Heim einrichtete, fand der Nuntius, ein begeisterter Heraldiker, wirklich das Wappen in den Londoner Archiven und hielt es in seinem in englischer Sprache verfassten Buch fest.  MIT MEINEM ONKEL AUF DEM PFERDEWAGEN Unser schöner Bauernhof in der Gegend von Jessen, sieben Kilometer von Wittenberg, ist heute ziemlich heruntergewirtschaftet. Die Fotos, die mir kürzlich zugeschickt wurden, hätte ich meinem Vater nicht zeigen dürfen. Er wäre ohnmächtig geworden vor Wut. Mit meinem Onkel, einem Metzgermeister, zog ich donnerstags oft mit dem Pferdewagen über Land. An den Gaststätten wurde das Fleisch abgeliefert. Während er überall zu einem Trunk eingeladen wurde, interessierte ich mich für die Spielautomaten. Einen durfte ich nicht mehr benutzen, weil ich ihn mit einem Trick leeren konnte. Bei einem Lehrer, der auch Fleisch von meinem Onkel bezog, durfte er in der Scheune mit seinem Pferd weinselig schlafen. Ich war stolz, auf dem Bock neben ihm zu sitzen, wo der Onkel auf dem Wege nach Hause regelmäßig einschlief. Wenn das Pferd auf dem Hof scharrte, hob ihn die herbeigeeilte Cousine vom Bock und brachte ihn zu Bett. Das Pferd lief allein in den Stall, wo das Futter bereitstand. Unsere Familie war die einzige katholische im Ort, in der protestantischen Gegend. KLOSTERLEBEN in der Abtei Münsterschwarzach 1934-1949 Zum besseren Verständnis: Am 1. Oktober 1934 wurde Egino G. Weinert in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach bei Würzburg als Lehrling aufgenommen. Er wollte und sollte einmal dort Ordensmann werden. Diese jungen Männer wurden damals —Bruderzöglingež genannt und banden sich größtenteils mit etwa 18 Jahren an die Klostergemeinschaft. Vor Ostern 1934 wurde er mit einer Gruppe Berliner Jugendlicher für drei Monate vor der Schulentlassung zu einem Ferienaufenthalt in das Benediktinerkloster Münsterschwarzach geschickt. Nach seiner Rückkehr orientierte er sich in der Zwischenzeit in einer Werkstatt für Glasmalerei und Mosaiken von August Hoff. Wunschgemäß fand er dann im Herbst 1934 Aufnahme in Münsterschwarzach. Von Klostergemeinschaften sagten ihm die fränkischen Missionsbenediktiner am meisten zu. Es war wohl die Kombination aus Mönchtum und missionarischem Wirken, die den jungen Günter Weinert faszinierte, und natürlich die vielen Werkstätten, in denen die Brüder für das Heimatkloster und die Mission ihre Talente einbringen konnten. Hier erhoffte er sich, durch seine künstlerische Neigung und Fertigkeiten Zugang zur Mission zu finden. Münsterschwarzach ist eines der ältesten Klöster Frankens. Es wurde bereits 816 gegründet. Nach wechselvoller Geschichte, in welcher Mönche auch in künstlerischer Hinsicht Großartiges geleistet hatten, wurde die Abtei 1803 wie fast alle Klöster Bayerns verstaatlicht und aufgehoben. Das klösterliche Leben erlosch und die großartigen Bauten, etwa die viel gerühmte Basilika, die nach den Plänen Balthasar Neumanns erbaut worden war, verfielen. Neues Leben sollte erst im 20. Jahrhundert einkehren. 1901 gründete die —Benedictus-Missionsgenossenschaftž von St. Ottilien (Landkreis Landsberg/Lech) eine Niederlassung im ehemaligen Kurbad St. Ludwig am Main (Landkreis Schweinfurt). Gedacht war sie als Erholungsstätte für heimkehrende Missionare, denn das Mutterkloster St. Ottilien (heute Erzabtei) hatte schon im ehemaligen Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) Missionsstationen aufgebaut. Doch aus St. Ludwig entwickelten sich eine Schule mit großen Zulauf und ein eigenständiges Kloster. Aber weil vor allem die wirtschaftlichen Möglichkeiten - ein Kloster hat sich selbst zu unterhalten - für die wachsende Zahl von Ordensleuten unzureichend waren, erwarb man 1913 das ehemalige, ruinöse Kloster Münsterschwarzach, das nur etwa 20 Kilometer entfernt war und vor allem ausreichend Ackerland besaß. Schon 1914 wurde das Kloster zur Abtei erhoben und Placidus Vogel als erster Abt ernannt. Dieses Amt hatte er bis 1937. Dieser Abt war für den jungen Günter Weinert der oberste Vorgesetzte. Ihm folgte als Abt Burkhard Utz, der bis 1959 amtierte. Münsterschwarzach gehört der Kongregation der Benediktiner von St. Ottilien an. Zu diesem Klosterverband zählen Klöster in Deutschland, der Schweiz, Österreich, USA, Tansania, Kenia, Venezuela, auf den Philippinen und in Südkorea. In den Missionen sind diese Klöster Zentren religiösen Lebens, sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts. Richtschnur ihres Lebens und ihrer Arbeit ist die Regel des Heiligen Benedikt von Nursia. Die Tradition nennt das Jahr 480 als sein Geburtsjahr. Von dem verlotterten Leben in Rom abgestoßen zog er sich als Asket nach Subiaco zurück. Er ließ sich auf dem Monte Cassino nieder, wo er mit einigen wenigen Mönchen das Mutterkloster des abendländischen Mönchtums gründete (um 529 n. Chr.). Seine Ordensregel ist nicht in einem Guss entstanden, sondern langsam gewachsen. Die wichtigsten Elemente sind die —stabilitasž, also die lebenslange Bindung an die klösterliche Gemeinschaft, der Gehorsam und die persönliche Veränderung und Ausrichtung des Lebens ausschließlich auf Gott hin. Um dieses hohe Ziel zu erreichen, ist der Mönch eingespannt in einen ausgewogenen Rhytmus aus den einzelnen Chorgebeten einerseits und den aufgetragenen Arbeiten andererseits. Kurz: —ora et laboraž (bete und arbeite). An der Spitze eines Klosters steht der Abt. Der Prior ist sein Stellvertreter und der Cellerar ist für die Wirtschaftsverwaltung des Klosters zuständig. Als sich Egino der benediktinischen Gemeinschaft von Münsterschwarzach anschloss, war das Klosterleben ungleich härter als heute. Der Tag begann um 4.30 Uhr mit Chorgebet und Messe. Bis zur Komplet, dem Abendgebet um 20 Uhr, war der Tag angefüllt mit Arbeit und zu bestimmten Tageszeiten unterbrochen von Mahlzeiten und gemeinsamen Gebet. Nach dem 2.Vatikanischen Konzil hat sich die vormalige Strenge gelockert, doch klösterliches Leben besteht immer noch aus dem Wechsel zwischen Gebet und Arbeit. Auch die damaligen Unterschiede innerhalb der Klostergemeinschaft zwischen Patres (Mönche mit Priesterweihe) und Laienbrüdern, die Handwerksberufe ausübten, gehören längst der Vergangenheit an. In den 30er Jahren unterschieden sich Patres und Brüder schon äußerlich durch ihren Habit (Ordensgewand). Auch hatten nur die Patres ein Stimmrecht in allen innerklösterlichen Belangen. Heutzutage haben alle Patres und Brüder, die die Ewige Profess abgelegt haben, die gleichen Rechte und bilden gemeinsam den Konvent. Für Egino Weinert waren die 15 Jahre im Kloster die prägendste Zeit seines Lebens. Sie vermittelte ihm nicht nur ein vielfältiges Wissen und eine Vertiefung seines Glaubens, sondern vor allem eine breitgefächerte Grundlage für sein späteres Schaffen als Goldschmied, Bildhauer und Maler sakraler Werke. Nach eigener Aussage war die Zeit in Münsterschwarzach für ihn trotz mancher Enttäuschungen —eine sehr schönež. Und der Hl. Benedikt habe ihn —sehr geprägtž. Tatsächlich zieht sich durch das Schaffen des Künstlers als auffallende Konstante seine Prägung durch das benediktinische Klosterleben in Münsterschwarzach. DAS LEBEN ALS MÖNCH: EINFACH und GLÜCKLICH Egino G. Weinert berichtet: Zum Chorgebet bin ich gerne gegangen. Wir standen damals morgens um 4.30 Uhr auf. Ein Bruder weckte mit einer Glocke. Der Schlafsaal war mit sechzig Brüdern belegt. Die einzelnen Schlafzellen waren durch Vorhänge abgetrennt, die Älteren hatten einen Raum zu zweit oder viert. Bei dem Ruf —Benedicamus dominumž, antworteten wir —Deo gratias! Laudetur Jesus Christus in aeternum. Amen.ž Man war noch ganz im Schlaf. Im Winter war es dazu noch lausig kalt. Wir mussten erst das Eis in der Waschschüssel einschlagen. Es gab keine Federbetten, nur Decken und Strohsäcke, die einmal im Jahr erneuert wurden. Ich hatte jeden Morgen Schwierigkeiten mit dem Aufstehen und dachte bei mir, ob ich das ein Leben lang durchhalte? Kaum aber war ich aus dem Bett, stand ich schon an der Waschschüssel und rannte durch den Garten zur Kirche. Das Chorgebet erfüllte mich so mit Jubel, dass alle Schwierigkeiten zerstoben. Aber auch in die Kirche nahm ich manchmal Papier und Zeichenstift mit, und wenn es mich überkam, machte ich schnell, versteckt hinter dem Chorgestühl, eine Notiz oder Zeichnung; eigentlich schon eine kleine Sünde. Manches, was Benedikt in seiner Regel aufgeschrieben hat, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Schweigen sollte man stets, mit gesenktem Haupt sollten wir gehen. Ob das auch in der Regel steht? Ich stand in der ersten Reihe. Alle kamen an mir vorbei. Ich konnte sie an den Füßen und Schuhen erkennen. Wir Brüder durften kein Latein lernen. Ich wäre sehr daran interessiert gewesen. Die gemeinsamen Abende im Kloster waren immer sehr schön. Ich meine, man kann auch alleine beten. Aber das gemeinsame Beten hat mir in meinem späteren Leben immer gefehlt. Einmal im Jahr auf dem Gartenfest zu Johannis, am 24. Juni, bekamen die Brüder eine Flasche Bier, jeden Freitag Apfelmost und Käse. So wie die Bayern essen, kannten wir es in Berlin nicht. Zum Frühstück gab es Brot mit Marmelade ohne Margarine oder einem Stück Wurst. Ich habe immer von schönem Essen geträumt. Das klösterliche Leben war karg und schlicht. Aber ich war ein sehr glücklicher Mensch im Kloster. GEDANKEN ÜBER DIE —GLÜCKLICHE SCHULDž Osternacht im Kloster! —Oh glückliche Schuld!ž Die besten Sänger, die wir im Kloster hatten, haben diesen festlichen Gesang in der Osternacht ganz feierlich vorgetragen. Uns lief es kalt und warm über den Rücken. Damit ist die Menschheit dem Himmel zugeführt trotz der Sünde, aber Gott selber hat uns angenommen. Die Barmherzigkeit Gottes war größer als alles, was vorher da war. Doch das Leid der Menschen ist geblieben. Jeder Mensch leidet bis zum Schluß und ist dem Bösen konfrontiert. Augustinus sagt, das Leid würde vergehen: Leid ist Lüge, der Teufel ist Lüge und das vergeht. Die Frage ist, ob es bei dem Großen Gericht noch einen Teufel gibt, oder ob er dann zerstört wird, so dass das Böse nicht mehr existiert. —Oh glückliche Schuldž - das hat die Kirche durch alle Jahrhunderte musikalisch und literarisch aufgearbeitet. Ohne die Sünde hätten wir nie die erbarmende Liebe Gottes erfahren. Wie wunderbar, dass Gott immer alles zum Besseren lenkt und seine Herrlichkeit immer wieder größer offenbart.  KLOSTERERLEBNISSE Ich träume noch heute von den alten Mönchen die schönsten Träume. Ich sehe im Kloster die Mönche beim Beten, gehe zu ihnen hin und frage sie, wie sie so ruhig beten können, ich hätte das nie so fertig gebracht. Sie antworten: —Wenn du Gott erfahren hast, passt du dich an.ž Bevor die Mönche in den Chor schreiten, kehren sie in sich. Es geht durch sie hindurch wie ein Geist, und sie erleben, wie man betet, was man betet, wie man sich vorbereitet. Ich sehe sie schwebend wie Engel in den Chor hineinschreiten. Diesen Traum habe ich nicht nur einmal geträumt. Ein andermal träumte ich, daß jeder mir erzählte, wie er von Gott erfaßt sei. Ich weiß nur, es war eine Seligkeit, die man gar nicht steigern kann. Und sah, sie haben gebetet. Ich habe gesehen, wie der Himmel sich freute. Keine Sorge, ich habe keine Engel gesehen! Ich glaube, das wird so schön, wenn wir den Schöpfer sehen. Andere sagen, wir müssen ganz neue Wesen werden, sonst würden wir verbrennen. Jesus sagte, wir werden seine Brüder, wir werden mit ihm eins werden. Dass wir dazu fähig sind? Ich denke an Pater Mathäus Hippler. Als Oberregierungsrat ins Kloster eingetreten, studierte er noch Theologie. Er hielt sehr, sehr lange Predigten über die Mutter Gottes. Wir lächelten alle, wenn wir zu ihm zur Beichte gingen. Vor einer Stunde kamen wir nie heraus, waren aber immer selig über das, was der Mann versuchte zu vermitteln aus seiner Lebensweisheit und Gottesliebe. Wenn er auf der Kanzel stand und sprach, dachten wir jeden Moment, er würde abheben, ja schweben. Vor der Messe suchten wir im Frühling Maiglöckchen im Wald und brachten sie zum Marienaltar. Kurz nach meinem Eintritt ins Kloster war Bruder Franz Blaser, ein Bildhauer, gestorben. Bei seiner Beerdigung erfuhr ich etwas Merkwürdiges. Er hatte gebeten, daß sein Sarg vor das von ihm geschaffene Muttergottesbild an der Hauswand aufgestellt und dazu das —Salve Reginaž (Sei gegrüßt, Königin) gesungen werden sollte. Ein Vogel setzte sich auf die Steinplastik und sang und sang inmitten der dreihundert Leute. Frater Maurus Kraus, Professor der bildenden Künste aus München, der gerade als Bruderoblate in den Orden eingetreten war, hatte die bayerische Krone dieser Madonna, ohne jemanden zu fragen, über Nacht stark verändert. Das gab viel Ärger im Kloster, denn ein Vorgesetzter wachte über die Kunstwerke, in unserem Fall Pater Wunibald Kellner. Nichts durfte an die Öffentlichkeit, ohne von ihm abgesegnet zu sein. Frater Maurus sagte später öfter: —Es ist nicht leicht, Künstler im Kloster zu sein.ž —GEHT IN DIE WELT ...ž Viele Mönche wollten nicht Priester werden, sondern dienend im Hintergrund bleiben. Wir haben nicht gekuscht. Ich war einer der wenigen, der eine —Berliner Schnauzež hatte und sie dem Abt gegenüber auch mal aufgemacht hat. Die anderen hatten einfach nicht den Mut, Missstände beim Namen zu nennen. Brüder waren gelegentlich Dienstboten der Oberen. Sie konnten früher nicht wählen, nicht die Geschicke der Gemeinschaft mitbestimmen, weil sie keine Konventualen, keine stimmberechtigten Mitglieder des Klosters waren, die sich entgegen der Aussage Benedikts auch abhoben durch andere Kleidung. Die Patres trugen augenfällig eine andere Kapuze und einen weißen Kragen. Nach Benedikt aber durfte es keine Unterscheidung geben, nur das Alter der Zugehörigkeit zum Kloster war ausschlaggebend. Die Benediktinerklöster Maria Laach und Beuron bewirkten eine Veränderung. Aber uns wurde immer gesagt: —Wenn Ihr nicht glücklich seid im Kloster, geht in die Welt ...ž Regeltreue verlangte: pünktlich zum Gottesdienst, pünktlich zum Offizium, dem Chorgebet, zu erscheinen. Ich habe mir Mühe gegeben, pünktlich zu sein. Aber wie Bruder Bonifaz Nüdling kam ich oft zu spät. Wir litten beide darunter. Er war ein guter Bildhauer, der jedes Mal, wenn ein Stück fertig war, zur Posaune griff und —Großer Gott, wir loben Dichž spielte. Als Junge war ich neugierig, aber ausgesprochen schüchtern. Auf Urlaub aus dem Kloster bei meinen Eltern verbot mir mein Vater, mir meine Haare, wie es im Kloster zu der Zeit üblich war, ganz abschneiden zu lassen. Zurück im Kloster wußte ich nicht, wie ich das dem Schuldirektor erklären sollte. —Ach Quatschž, meinte der, —Rübe runter. Es gibt nichts anderes als Glatze.ž Typisch für mich war: ich ging in die Kirche und klingelte den Abt in den Beichtstuhl. Tatsächlich kam der alte, gütige Abt Plazidus Vogel. Unter Tränen brachte ich mein Anliegen vor. —Ach, Junge, daran hängt doch kein Ordensberuf, Hauptsache deine Seele ist in Ordnung.ž Ich war der erste, der im Kloster längere Haare tragen durfte. Für den Menschen, der Gott sucht, bietet das Kloster einen wunderbaren Weg. Die Berufsfindung für mich war sehr schwer. Ich versuchte, mich als Bruder einzuordnen. Meine Vorstellung, als Maler und Bildhauer ausgebildet zu werden, fand keine Unterstützung. Man wollte damals Handwerker für die Missionen ausbilden. Brüder, die aus der Mission in Korea, Venezuela, Afrika und Nordamerika kamen, gaben interessante Berichte und führten uns vor Augen, welche missionarischen Möglichkeiten sich in klösterlichen Gemeinschaften böten. In Asien würden zum Beispiel die Darstellungen in Emaillebildern als Geschenk des Himmels betrachtet. Damit zu wirken, sei besser als jede Predigt. Mit Pater Alwin Schmid stand ich bis zu seinem Tod in Verbindung. In Korea gestaltete er über dreißig Kirchen als Maler und Architekt. Bruder Vitus Stenger baute dort in Seoul eine große Druckerei auf. Nachwuchssorgen kennt man da nicht. Über die Kirchen und Kirchenmalereien von Pater Polycarp Ühlein in Afrika ist ein eindrucksvoller Bildband in Münsterschwarzach erschienen. Das Malen aber wurde im Kloster zu meiner Zeit nicht erlaubt, wahrscheinlich wegen der dazu notwendigen umfassenden Anatomiestudien. Das hatte schon in der Zeit vor mir, so um 1926, Pater Alwin Schmid, Schüler des Malers, Grafikers und Schriftstellers Richard Seewald in Köln erfahren müssen. Pater Wunibald Kellner als der künstlerische Leiter der noch im Aufbau befindlichen Werkstätten hatte sich für mich auch einen späteren Einsatz in Südkorea vorgestellt.  AUSBILDUNG UND GESELLENZEIT Während ich als kaufmännischer Lehrling ausgebildet wurde in Versand, Expedition, Buchhaltung, Herstellung und Drucken von Zeitschriften und Werbung, lernte ich, mehr im Vorübergehen, Werkstätten der Abtei, die Druckerei, Buchbinderei, Schmiede, Bildhauerei, Faßmalerei und Schlosserei kennen. Zuerst aber habe ich ein Jahr mit der Arbeit in der Landwirtschaft zugebracht. Es dauerte ein halbes Jahr länger als üblich, da sich meine Vorgesetzten nicht darüber klar werden konnten, was sie mit mir machen sollten. Sie hatten Bedenken, mich in die Kunstbetriebe zu stecken, warum weiß ich nicht. Vielleicht hatten sie Sorge, daß ich mit der —Körperlichkeitž zu sehr in Verbindung käme. Ich war aber ein ganz unbescholtenes Jüngelchen. Ich kam in die Schreinerei, wo ich ein Vierteljahr lang arbeitete. Erst wurde Holz getrocknet, im Sägewerk zugeschnitten und verleimt. Bretter wurden getrocknet. Alles Holz, das im Kloster verarbeitet wurde, konnte gestapelt, vorgetrocknet oder in einem Trockenhaus untergebracht werden. Ich habe Bilderrahmen gefräst und hergestellt, Kisten verzahnt und verzapft, habe geholfen, Kirchenbänke herzustellen. Von der Druckerei wurde ich manchmal aufgefordert, Holz-, Linol- und Scherenschnitte für Titelseiten zu machen. Ich half beim Einbinden der Bücher, beim Vergolden und Polieren der Gebetbücher. Den Buchdruck lernte ich im Kloster bei der Herstellung eines Kalenders kennen. Ich wurde auch eingeführt in den Fotodruck auf Aluminiumfolie, auf Zellophanfolien, später auch im Steindruck. Dabei wird das Bild auf Stein gelegt, abgelichtet und geätzt. Ich sah mir immer alles genau an. Man musste damals mit der Hand das Blatt nehmen, einlegen, zusammenfalten zum Druck und mit der anderen Hand wieder wegnehmen, ein gefährliches Tun für die Hände an der rotierenden Maschine. Das regte mich zu einer Erfindung an. Wir mussten jedes Jahr in der Freizeit nach dem Essen die Kalender zusammenstellen. Zweiundfünfzig Blätter lagen auf den Tischen. Überall ein Stoß und man hatte zum Stapeln ein Dreieck aus Holz, um hintereinander von jedem Stoß ein Blatt einzulegen. Mit Bruder Severin Krönung überlegte ich, ein Karussell zu bauen, in das die zweiundfünfzig Blätter ringsherum hineinpaßten. Wir nahmen eine ausgediente —Heidelbergerž, eine Druckmaschine, die die Blätter ansaugte und hinlegte, bauten einen kleinen Motor ein, der das Karussell drehte. Die Konstruktion erregte anfangs Aufsehen, passte aber wegen der Größe leider nur in den Theatersaal. In der Berufsschule lehrte Bruder Waldemar Nordmann, ein früherer Architekt aus Essen, Mathematik und Geografie. Wir sechzig Schüler sollten den Inhalt einer Fläche verdoppeln auf rechnerische und zeichnerische Art nach einer bestimmten mathematischen Formel. Der Professor fand meine Lösung der Aufgabe ungewöhnlich. Er nahm meine Zeichnung mit nach Hause und erteilte mir am nächsten Tag eine Eins. Er fand die Art meiner Ausrechnung nicht im Lehrbuch. BEURONER STIL In der Klosterschule lernten wir im —Beuroner Stilž zu arbeiten. Zu der Zeit die gesuchte Kunst in der Kirche, streng, symmetrisch, erhaben, majestätisch. Bruder Adelmar hatte sie, als Geselle aus dem Kloster Beuron kommend, in der Goldschmiede eingeführt. Die Kirche in St. Ludwig war von den Beuroner Brüdern ausgemalt worden. Die Beuroner Kunstschule wurde von Pater Lenz 1894 gegründet. Er strebte eine Erneuerung der kirchlichen Kunst an. Diese Kunstrichtung war eine Absage an den herrschenden Naturalismus, dem viele Künstler nachstrebten bis zum Ersten Weltkrieg, bis sie dann an Kraft verlor. Ich dachte, so was Kitschiges. Du malst richtig witzig schöne Heiligenbilder. Mein Urteil hat man mir gelegentlich verübelt. Einige Mitbrüder jedoch waren begeistert, und so wurden auch Scherenschnitte von mir in dem vom Kloster herausgegebenen Kalender verwendet. In den Kunstwerkstätten des Klosters durfte ich, entgegen meinem sehnlichsten Wunsch, keine Ausbildung machen. Ich mußte vielmehr den Kaufmannsberuf erlernen. Ich bekam keinen Lehrvertrag. Das Lehrlingsheim des Klosters war ein berufbezogenes Internat, um Brüderberufe heranzuziehen. Unser Präfekt schickte mich oft zum Bauzeichnen. Da konnte ich Zeichnungen und Lichtpausen von der Kirche anfertigen, die gerade gebaut wurde. Einige Patres sorgten dafür, dass ich ein halbes Jahr doch in die Bildhauerei kam. So durfte ich an der Kanzel zwei Figuren aus Stein hauen und mit Bruder Bonifaz Nüdling gleich hinter dem Eingang die erste von vier Figuren. Fast ein Jahr lang lernte ich bei Bruder Lukas Mahler Fassmalen kennen; das ist das Vergolden und Versilbern, die Bemalung von Stein- und Holzskulpturen und das Kirchenmalen. Die Türgriffe für die Kirche mußten in Bronze gegossen werden in der kleinen Gießerei, die gleichzeitig auch Schlosserei und Schmiede war. Der Schmelzofen stand in einem kleinen Raum. Anfangs habe ich auch etwas modelliert, doch viel zu dick. Es floss nicht aus, als ich es zu gießen versuchte. Für die ganze Kirche brauchten wir neue Altarleuchter. Es waren auch kleine Kapellen und Seitenaltäre einzurichten. ALS POSTULANT UND NOVIZE Nach zwei Jahren kaufmännischer Lehre wurde ich am 25. April 1937 Postulant, so heißt der Ordenskandidat während der Probezeit, und bekam mein erstes Ordenskleid. Bei der Zeremonie fragt der Abt: —Was wünschen Sie?ž und der Postulant antwortet: —Die Liebe Gottes, die Gemeinschaft der Brüder.ž Das Postulat ist die erste Vorbereitungszeit eines Bewerbers zur Aufnahme in eine Klostergemeinschaft nach Ordensrecht. Als Postulant setzte man mich zuerst in der Küche als Koch ein und das den ganzen Tag. Für dreihundert Leute Kochvorbereitungen zu treffen war gar nicht so einfach. Außerdem war ich als —Berliner Jungež wirklich sehr schwach. Die große Kelle im Topf konnte ich nicht einmal herumrühren. Es war eine schwierige Zeit, man wurde hingeschickt, wohin man eigentlich nicht wollte. Dann teilte mir Pater Wunibald Kellner mit: —Wir haben uns entschlossen, Sie die Goldschmiedekunst erlernen zu lassen, einen Beruf, in dem Sie zu sorgfältigem Arbeiten angeleitet werden. Denn Sie sind etwas fusselig, ein Hans Dampf in allen Gassenž. Aber ich wollte doch Maler werden und Bildhauer. AUSBILDUNG ZUM GOLDSCHMIED (11.7.1937-11.7.1940) Ich kam in die Goldschmiede zu Bruder Adelmar Dölger, einem gelernten Schreiner, der den Gesellenbrief als Goldschmied in Beuron von 1930-34 erworben hatte. Er wurde mein Vorgesetzter. Er hatte seine Ewige Profeß, das sind die Ordensgelübde, 1934 abgelegt und 1937 die Goldschmiedewerkstatt eingerichtet, wo ich sein erster Lehrling wurde. Bruder Adelmar hat mich ziemlich streng behandelt. Monatelang hat er mich kleinste präzise Winkel feilen lassen, wobei ich - im Nachhinein betrachtet - allerdings viel lernte. Sie mußten graviert und emailliert werden. Durch Löten wurden kleine Stifte unter die Winkel angebracht, die wiederum in großer Anzahl auf einem Leuchter angebracht wurden. Der erste Leuchter, der vor dem Muttergottesaltar steht, war noch eckig modelliert, die späteren Leuchter und Werke wurden runder. Bei Bruder Adelmar durfte ich nicht zeichnen, keine eigenen Entwürfe und Ideen einbringen, wozu es mich immer so drängte, denn er wollte den Ton angeben. Viel später merkte ich, daß er Werke von mir als die seinen ausgegeben hatte. Als ich 1986 an seinem Sterbebett stand, sagte er, ich sei der Beste von allen gewesen. Jedes Jahr schickte ich meiner Mutter die Zeichnung von einem Kreuzweg, einem Sonntagsevangelium oder einer Epistel. Nach einjährigem Postulat wird man normalerweise für ein Jahr Novize, so heißt der Mönch auf Probe. Am 27. April 1938 wurde ich als Novize aufgenommen. Ich erhielt den Namen des heiligen Egino, der mein Patron wurde. Ich wurde einem neuen Oberen vorgestellt, dem Novizenmeister. In meinem Fall war es Pater Wunibald Kellner. Er hatte es verstanden, zwanzig Bildhauer in seinen Kunstwerkstätten zu beschäftigen. SILENTIUM, ZEIT DER STILLE Ein Pult mit einer Klappe für zwei Mann in Reihen hintereinander, sechzig Leute im Saal und Silentium. Vorne saß der Präfekt, las oder studierte wie wir. Bruder Severin stellte die Klappe seines Pultes hoch und reparierte dahinter Uhren. Wurde er entdeckt, mahnte der Präfekt laut ihn an, mitten im Silentium. Aber wir hatten doch keinen Uhrmacher, und Bruder Severin Krönung war unser Spezialist. Wir in der Goldschmiede bekamen von Wohltätern gestiftete Uhren, Trachtenschmuck, Silber, Bestecke, getriebene Silberkannen. Diese sollten wir einschmelzen. Auch sehr alte, kostbare Kreuze tauchten da auf (aus denen Bruder Adelmar die Rubine und Smaragde herausdrückte und den Rest einschmolz). Wir entdeckten die tollsten Dinge aus den Nachlässen: Uhren, die eine Feder besaßen und über Zahnradketten mit einem Schlüssel aufgezogen werden konnten oder Marmeladeneimer voll wertvollster Uhren. Unser Hobby als Lehrlinge war es, die Dinge aus Bruder Adelmars Zimmer zu holen und zu reparieren. Ich habe viel Schönes dabei gelernt. Manchmal lief ich verzweifelt zum Abt: Ich wolle doch kein Goldschmied werden, sondern Maler. Mein Wunsch blieb aber völlig unbeachtet. Einmal schleuderte Bruder Adelmar genervt die Kiste mit den Edelsteinen aus dem Fenster der Goldschmiede auf den darunterliegenden Misthaufen. Einzeln habe ich sie sorgfältig wieder rausgelesen. Im Kloster war auch Bruder Flavian Lanninger, Maurermeister und hervorragender Graphiker. Um im Kloster frei arbeiten zu können, legte er keine Gelübde ab. Er hatte als Oblate nur das Versprechen gegeben, dem Kloster anzugehören, lebte freier. Vom Klosterverwalter wurde er sehr gefördert; er schrieb ganze Evangelienbücher auf Pergament und malte sie aus. Das war damals das Größte für mich. Wenn es die Zeit erlaubte, schaute ich ihm dabei zu. Er ließ mich malen, denn wir waren beide gute Freunde geworden. Als Oblate brauchte er am Chorgebet nicht teilzunehmen, er malte stattdessen. Bruder Maurus Kraus hat mich immer ermutigt: —Egino, was du tust, ist gut. Laß dich nicht irre machen. Ich würde nie so arbeiten, aber ich erkenne alle deine Arbeiten an.ž So ein kluges Gespräch habe ich selten bei einem anderen Mitbruder erfahren. Bei seinem späten Eintritt ins Kloster hatte der Abt dem Frater Maurus sogar gestattet, sein altes Empireschlafzimmer in die Zelle mitzubringen. Ihn zu besuchen, war nicht erlaubt. Aber ich bin als junger Bruder hineingeschlüpft, das Anatomiebuch unter dem Arm und habe meine Werke und Entwürfe vorgelegt, um sie korrigieren zu lassen. Später aber durfte ich dem alten Bruder ab und zu Kaffee bringen und einen Moment Platz nehmen. Wir sprachen über Kunst und Künstler. Er vertrat den Standpunkt, dass es in der Kunst keine absolut gültigen Maßstäbe geben dürfe. Ich hatte ihn gefragt, wer der größte Künstler in der Geschichte sei. —Den gibt es nicht, den Gedanken musst du vergessen. Jeder ist ein großer Künstler, jeder, der gut ist. Dürer war ein großer Mann, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Was schlecht ist, kann man sagen. Was gut ist, das ist ein Geheimnis.ž Aus den Gesprächen mit dem fast 70jährigen Frater Maurus Kraus lernte ich als 17jähriger sehr viel. Die Bildhauer Bonifaz Nüdling und Arnold Burger, der im Krieg beide Hände fast ganz verloren hatte, haben mich gerne geholt, wenn es etwas zu helfen gab, wie etwa zum Leimen oder Nasshalten der Tonfiguren, da ich Kenntnisse aus der Schreinerei mitbrachte. Sie forderten mich auf, auch mal einen Christus zu modellieren. Dafür bezogen sie später einen Rüffel von dem Leiter der Bildhauerei. Bruder Bonifaz sollte Heiligenfiguren modellieren, hatte aber kein Modell. Daraufhin zog ich meinen Habit aus, um ihm Modell zu stehen. Genau in dem Moment erschien Pater Wunibald Kellner in der Werkstatt, knallte die Türe zu: —Das geht zu weit! Anziehen, hinknien, Segen, Buße, vom Boden essen!ž Das bedeutete, vor allen kniend vorne im Speisesaal vor dem Abt vom Stuhl das Essen einzunehmen. Ein heute undenkbares Verhalten. Alle schritten wie immer schweigend zum Essen. Der Abt aber konnte sich die plötzlich einsetzende Heiterkeit hinter mir im Raum nicht erklären: Er konnte die Fratzen nicht sehen, die ich auf meine Schuhsohlen gemalt hatte und die beim Knien mit jeder kleinen Bewegung der Füße anfingen sich lustig zu verändern. In Köln findet man schon im 11. Jahrhundert die Verehrung vom Herzen Jesu erwähnt. Dazu haben wir heute nur noch wenig Beziehung. Aber wir sagen ja oft —Du bist mein Herzž. Und warum sollen wir das nicht auch zu Jesus sagen? Weil ich der Kleinste war, mußte ich als Novize in der ersten Reihe vor einem riesigen Herz-Jesu-Gemälde von Feuerbach beten: Jesus, der seinen mächtigen Mantel ausbreitet, aus dem Feuer sprüht. Als Nolde-Fan dachte und malte ich doch so ganz anders. In meiner heutigen Herz-Jesu-Darstellung stelle ich Christus als Keltertreter dar. Ich hatte auch einmal eine schwere Phase in der Klosterzeit. Ich sah in allem keinen Sinn mehr. Eine depressive Phase, in der ich alles als sehr belastend empfand. Über sexuelle Probleme sprach man nicht. Sie waren tabuisiert. Die einzige Möglichkeit, damit fertig zu werden, war mit Gebet, mit gutem Willen und mit Beichte. Unser Beichtvater sagte: —Junge, es gibt Feldherren, die schlagen Schlachten und machen Politik, das ist eine große Leistung, aber eine noch größere ist es, mit sich selber fertig zu werden. Und das geht ohne weiteres.ž  ENDE MEINER LEHRZEIT IN WÜRZBURG 11.7.1940 Als Bruder Adelmar 1939 zu seiner Meisterprüfung als Goldschmied nach München zu Professor Schmidt geschickt wurde, kam ich zur weiteren Ausbildung zu Goldschmiedemeister Beßler nach Würzburg. Ich wurde im dortigen Benediktinerkolleg St. Benedikt in einem Saal unter dem Dach untergebracht, wo wir fünf Brüder vom Balkon aus den herrlichsten Blick auf die Residenz und den Hofgarten hatten. Gleich gegenüber fand das Mozartfest statt. Natürlich schliefen wir nicht. Wir schoben unsere Betten raus auf die Dachterrasse und haben liegend die Konzerte miterlebt. Beßler war ein großartiger Goldschmied, er ließ mich fast den ganzen Tag lang entwerfen. Ich durfte bei ihm Gravuren machen, Kelche entwerfen, Christusfiguren aus Kupfer treiben. Ich war völlig frei, meine Fähigkeiten auszuprobieren. Ich kostete ihn ja nichts. Alle paar Monate kam Bruder Adelmar aus München nach Würzburg, um nachzusehen, was ich gelernt hatte, und sah meine Entwürfe. Unter Bruder Adelmar hatte ich nicht zeichnen dürfen. Da war ich auf den stillen Ort geflohen, um dort meine Scherenschnitte schnibbeln zu können. Um vier Uhr früh hieß es in Würzburg —Aufstehen!ž, aufs Käppele zum Gottesdienst. Das ist eine Wallfahrtskirche oben am Nikolausberg, eine von Balthasar Neumann erbaute Kirche. Die Meister aber blieben zum Frühschoppen unten. Als wir wieder herunterkamen, waren sie —blauž, und wir durften in der Werkstatt arbeiten. Morgens zog einer von uns Lehrlingen zum Bürgerbräu und füllte Tropfbier in zwei Krüge ab. Dieses Bier wurde auf den Ofen gestellt - offiziell hieß es, zum Polieren. Man braucht aber dafür nur sehr wenig. Die Lehrlinge und Gesellen tranken natürlich die beiden Krüge aus. Bei der Arbeit wurde als erstes die lauretanische Litanei zu Ehren der Mutter Gottes gebetet, das ist ein seit 1531 bezeugtes Gebet aus Ehrentiteln Marias. Z.B.: —Du Pfosten des Himmels, du Morgenstein, du Turm Davids, bitte für uns!ž, obwohl das eine weltliche Werkstatt war. Zum Metalldrücken gab es keine richtige Maschine, sondern so etwas ähnliches wie eine Nähmaschine, deren Pedale man treten mußte. Wenn der Meister nicht mehr treten konnte, mußten zwei Lehrlinge, einer links und einer rechts, einspringen. Kam ein Kunde, rief einer: —Kunde kommt!ž Die Meister merkten sich aber genau, wo wir bei der Litanei aufgehört hatten, und da wurde wieder eingesetzt. QUECKSILBER AUS DER REGENRINNE Auf der Festung Marienberg in Würzburg habe ich mit Meister Beßler an dem —Heiligen Kilianž, ein Wanderbischof aus Irland, der im 7. Jahrhundert als Märtyrer starb, und auch an der —Mutter Gottesž gearbeitet. Die riesigen, vier Meter hohen Figuren mußten feuervergoldet werden. Wir Lehrlinge stellten uns in die Figur und machten sie mit Feuer heiß. Von außen wurde sie mit Quecksilber, das mit Gold zu einem Amalgam angerührt war, eingeschmiert. Wenn sie von außen ganz laut riefen: —Es dampft!ž, mußten wir die Luft anhalten, damit wir das weiß verdampfende Quecksilber nicht einatmeten. Bei dem Ruf: —Ist gut!ž, war der Dampf verzischt, und die Figur wurde von neuem erhitzt. Der Meister sagte, wir bräuchten keine Angst vor dem giftigen Quecksilber zu haben, man werde schon über achtzig Jahre alt. Wir haben alle Kelche über einem Feuer unter einer Dachrinne feuervergoldet. Durch den Sog, der entstand, zog der Qualm hoch und über der Dachrinne ab. Alle paar Wochen wurde die Dachrinne ausgekehrt und das gesamte Quecksilber, das sich da niedergeschlagen hatte, aufgesammelt. Dabei hat man heute so eine Angst vor Quecksilber. Auf dem Hof stand ein großer Topf mit Zyankali zum allgemeinen Vergolden. Zum Zeichenunterricht wurde ich zu Richard Rother aus Kitzingen geschickt. Doch später durfte ich nicht mehr zu ihm hin, weil er sich als verheirateter Mann eine Freundin zugelegt hatte. Er ist später regelrecht verhungert. Heute findet man in vielen fränkischen Gaststuben seine Originale, mit denen er seine Weinrechnungen bezahlte. Seine Bilder, Holzschnitte, die oft Landschaften oder Weintrinker zum Thema hatten, sind heute sehr gefragt. In Würzburg machte ich auch Bekanntschaft mit den Arbeiten der Gebrüder Schiestl und mit Professor Burkardt. MEIN GESELLENSTÜCK: EINE CHORMANTELSCHLIEßE (1940) Mein Gesellenstück habe ich mit einer besonderen Technik hergestellt, und ich wüßte nicht, dass es irgendwo eine Beschreibung dieser Technik gibt. Ich habe auf Messing- oder Kupferplatten das Silber aufgelötet und in eine Brosche, genauer gesagt, eine Chormantelschließe, eingearbeitet, sie danach in verdünnte Schwefelsäure gelegt, die das Kupfer auffraß und das Silber stehen ließ. Als junger Mensch möchte man ja immer etwas machen, was die anderen nicht können. Außerdem machte ich eine Kupferdose, eine grüne Dose mit drei hohlgetriebenen Füßen und einer Kugel oben drauf an einem Tag. Meine Gesellenprüfung bestand ich am 11. Juli 1940 (mit Auszeichnung). Danach ging ich von Würzburg nach Münsterschwarzach zurück. Ich habe zwei Chormantelschließen gemacht, eine war mein Gesellenstück. Sie wird heute noch bei festlichen Anlässen benutzt. Viel wertvoller aber ist die, die ich später bei Frau Professor Treskow an der Werkschule in Köln schuf, eine besondere Chormantelschließe. Sie stellt die Verkündigung dar - Maria und der Engel mit der Frohen Botschaft - in Granulationen auf einer Silberplatte. WIEDER IM KLOSTER MÜNSTERSCHWARZACH Abt Burkard Utz war erstaunt, als er von meiner Gesellenprüfung erfuhr: —Was wollen Sie denn, heulen immer Rotz und Wasser bei mir und kommen mit so guten Noten, seien Sie mal ganz schön zufrieden. Sie sind ein tüchtiger Mann, Sie kommen wieder in die Goldschmiede.ž —Schicken Sie mich, wohin Sie wollen, aber nicht mehr in die Goldschmiedež, bat ich ihn. —Gut, wenn Sie das wollen, dann werden Sie Refektoriumswart.ž Das bedeutete: Putzen, Tischdecken und vieles mehr, vor allem aber Orgelspielen. Ja, das wollte ich sofort machen. Ich führte meine neuen Aufgaben aus. Doch dann kam der Abt und meinte, er brauche sechs Kelche für die Mission, die schnell gemacht werden müßten. Bruder Adelmar war beim Militär und so hatte ich die Möglichkeit, endlich selber zu entwerfen und alleine zu arbeiten. Jeden Kelch, dessen Form Bruder Adelmar nur maschinell gedrückt hatte, trieb ich einzeln mit der Hand, gravierte und emaillierte ihn - und der Abt war begeistert. Mein erstes Werk im Kloster, ein Weihwasserbecken, das —Die Rückkehr des Herrnž zum Thema hat, habe ich nie fertig gestellt, aber trotzdem auf Ausstellungen und Wettbewerben Auszeichnungen damit gewonnen. Es steht jetzt in meinem Ausstellungsraum in Königsdorf bei Köln. AUFLÖSUNG DES KLOSTERS 9. Mai 1941 Der Krieg machte auch vor den Klosterpforten nicht halt. Nachdem ich erst vierzehn Tage zur Luftwaffe eingezogen worden war, wurde ich —nach Hausež, also ins Kloster, zurückgeschickt. Ich hatte wieder einmal eine furchtbare Stirnhöhlenvereiterung. Während einer Kur in St. Ludwig, unserem Klösterchen bei Wipfeld am Main, einem ehemaligen Kurbad, versuchte man, mich mit Schwefeldämpfen zu kurieren. In den vierzehn Tagen malte ich viel, musste aber immer wieder zur Behandlung zu Dr. Ödinger nach Würzburg radeln. Eines Tages kamen die Nazis. Vater Abt Burkard wurde später in das Kloster der Oberzeller Schwestern gebracht mit strengen Auflagen. Seine Schwester Philomena war dort Novizenmeisterin. Er hatte Order, das Kloster in Oberzell nicht zu verlassen. Die Patres wurden mit wenigen Ausnahmen auf Laster verfrachtet und in ein Franziskaner-Kloster auf dem Kreuzberg in der Rhön verschleppt, von wo aus viele von ihnen zum Militär eingezogen wurden. Das alles kam so: Der Abt saß verzweifelt in seinem Zimmer während der Verhandlungen. Das Kloster wurde abgesperrt von Gestapo-Leuten. Er war im Grunde Eigentümer des Klosters und hatte einen Besitzanspruch. Die Nazis verurteilten ihn wegen persönlicher Bereicherung durch Betteln auf Kosten des Volksvermögens. Die Mönche bettelten ja für die Mission und hatten auch von solchem Geld Kirchen erbaut. Die Bewohner der Umgebung protestierten gegen diese Beschlagnahmung des Klosters. Sie strömten in großen Scharen herbei und leisteten Widerstand. Frauen warfen ihre Mütterorden vor die Füße der Gestapo in den Dreck und Männer ihre Kriegsauszeichnungen. (Über die Aufhebung der Abtei schrieb Pater Jonathan Düring 1997 zwei Bände mit dem Titel: —Wir weichen nur der Gewalt.ž) Ich stürzte hinauf zum Abt und sagte, ich müßte ins Krankenhaus, ich würde es vor Kopfschmerzen nicht mehr aushalten. Neben dem Abt saß ein Polizist und ein Nazi, Dr. Dengel, der das Kloster als Verwalter übernehmen sollte. Sie schickten mich weg, doch da rief der Abt: Sagen Sie dem Doktor Ödinger —Es wäre Zeit!ž - ein Code-Wort. Ich dachte, was soll denn das, nahm mein Fahrrad und fuhr nach Würzburg zu Dr. Ödinger, der gleichzeitig als oberster Sanitätsoffizier verantwortlich für die beschlagnahmten Klöster, Krankenhäuser und Lazarette war. —Ich soll Ihnen vom Abt bestellen, es wäre Zeit.ž Er konnte das nicht glauben. Kurze Zeit später war das Kloster von den Nazis befreit und statt dessen als Lazarett vom Militär beschlagnahmt. Ein furchtbarer Streit zwischen Militär und Nazis entbrannte, aber der Nazi Dr. Dengel verstand es, als Verwalter zu bleiben und Pater Theophil als Cellerar, also als Wirtschaftsverwalter. Der Rest der alten und kranken Priester und Brüder hatte, was die SS und SA nicht wußten, sofort die Kirche besetzt. Man hatte uns zwingen wollen, den Habit auszuziehen. Vergeblich! Heimlich wurde das Chorgebet von den wenigen, die bleiben konnten, in der Kirche hinter verschlossenen Türen den ganzen Krieg über weitergebetet, endlich auf deutsch, nicht wie vorher in Latein. Das war ja etwas, was ich auch immer gewünscht hatte. Dr. Dengel konnte sich gegen das Militär nicht in allem durchsetzen. Dadurch konnten wir Brüder dableiben. Wir wurden Angestellte des Lazaretts, wurden zum Dienst verpflichtet als Sanitäter, für die Landwirtschaft und andere Wirtschaftsbereiche. Hatte ein Bruder Heimaturlaub vom Militärdienst, verbrachte er den natürlich im Kloster-Lazarett mit seinen Klosterbrüdern. Bei dreihundert Mann war immer was los. Ein Pater war eingesetzt für unsere Betreuung, Pater Theophil. Er hielt beeindruckende Vorlesungen und Exerzitien. Jeden Tag wurde gebetet, jeden Tag die Heilige Messe gehalten, und alles schien wie früher. GRÜSS GOTT - HEIL HITLER Ich wurde vom Cellerar, Pater Theophil, zur Arbeit in den großen Hühnerstall versetzt. Auf dem Weg von der Goldschmiede zum Hühnerstall traf ich SA-Führer Dr. Dengel, den ich mit —Grüß Gottž grüßte. —Das heißt jetzt 'Heil Hitler'ž, verbesserte er mich. —Nein, bei uns heißt es immer noch 'Grüß Gott'.ž —So, wie heißen Sie? Sie werden ab jetzt immer mit 'Heil Hitler' grüßen. Sie kommen sofort zu mir in die Verwaltung!ž Und zu Pater Theophil gewandt: —Dieser Bruder hat ab sofort mit 'Heil Hitler' zu grüßen.ž —Das müssen Sie dem Bruder schon selbst überlassen, bei uns ist das 'Grüß Gott' üblich.ž —Wo kommen Sie denn überhaupt her? Ach so! Eine Berliner Schnauze!ž Er hat mich fertig gemacht, eine halbe Stunde lang, und wollte mich zwingen, mit —Heil Hitlerž zu grüßen. —Wenn Sie das nicht sofort befolgen - Sie haben eine Bedenkzeit bis vier Uhr - kommen Sie ins Gefängnis.ž Bei den Hühnern vergaß ich dieses Ungemach.  IM GEFÄNGNIS IN WÜRZBURG 1941 Aber um vier Uhr wurde ich in die Verwaltung gerufen. —Sie kommen ins Gefängnis, die grüne Minna steht schon draußen bereit. Packen Sie Ihre Sachen!ž Ich holte die Heilige Schrift, die Klosterregel, mein Anatomiebuch und den Rasierapparat. Auf dem Weg ins Gefängnis in der Ottostraße in Würzburg wurde mir schlecht, so dass das Auto gereinigt werden mußte. In der Zelle wurden nur die Hosenträger entfernt. Jeden Tag mussten wir auf dem Hof eine Stunde spazieren gehen. Ich, in meiner Kutte, begegnete noch einem Mitbruder, dem Bruder Hermann Kram, der mich kaufmännisch ausgebildet hat. Wir haben uns ab und zu zugewinkt. Ich erfuhr, daß Pater Sales Heß in das Konzentrationslager nach Dachau gesteckt wurde, wo er den ganzen Krieg über blieb. Ich sollte auch dahin, aber weil ich ein Jugendlicher war und der Abt sich zwischenzeitlich durch wohl gesonnene Mittelsleute für mich eingesetzt hatte, wurde ich nach einiger Zeit entlassen. Einmal wurde ich auf die Krankenabteilung verlegt, denn mit den Stirnhöhlen war es wieder sehr schlimm geworden. Eines Tages kam mein Vater in Parteiuniform mit seinem Holzbein ins Gefängnis gehumpelt, geschmückt mit seinem Eisernen Kreuz und all seinen Abzeichen aus dem Ersten Weltkrieg. Ich mußte ins Sprechzimmer kommen. Er forderte mich auf, aus der Kirche auszutreten, dann würde ich sofort entlassen. Da war noch ein anderer Gefangener, ein Metzgergeselle aus Dettelbach. Später habe ich von anderen erfahren, daß er —schwarzž geschlachtet hatte. Deshalb saß der im Gefängnis. Wir haben zusammen Körbe geflochten, wurden nach der Arbeitszeit aber immer getrennt. In der Zelle allein gelassen war es oft furchtbar. Polen, die sich mit einem deutschen Mädchen eingelassen hatten, wurden wegen —Blutschandež erschossen. Die Schüsse hallten bis in die Zelle. Einmal am Tag mußten, wir wie gesagt, eine Stunde im Kreis spazieren gehen. Da war einer, der bewegte sich, wenn ich an ihm vorbeikam, ganz verrückt. Ich dachte: Das ist einer, der spinnt. Zurück in meiner Zelle ging jemand draußen vorbei und strich immer wieder an meine Zellentür. Der muß irgendwie durch alle Gitter gekommen sein, dachte ich. Er rief: —Benedicite, Bruderž - das war unser Klostergruß. Ich antwortete nicht, weil ich dachte, er wolle mich aushorchen: —Was ist denn da draußen los?ž Mit Tränen erstickter Stimme antwortete er mir: —Na, gib doch eine Antwort, 'Benedicite'.ž Da sagte ich: —Deus.ž —Gott sei Dank, du bist es, Egino! Ich hab deine Papiere gesehen, du wirst entlassen. Wenn du rauskommst, geh zu Bischof Matthias Ehrenfried in Würzburg und sag', ich würde morgen erschossen. Es wird heißen, ich wurde auf der Flucht erschossen, aber das stimmt nicht. Ich war in der katholischen Jugend in Mainz und bin seit einigen Jahren im Gefängnis.ž Ich fragte ihn: —Wie bist du denn da überall durch und an meine Tür gekommen?ž —Tja, wenn du solange im Gefängnis bist wie ich, kennst du so viele Tricks. Aber gehe zum Bischof und sag' meiner Mutter einen schönen Gruß.ž Am nächsten Tag hörte ich Schüsse auf dem Hof. ROSA PAPIERE Nach etwa zwölf Wochen wurde ich tatsächlich entlassen. In der Verhandlung - das Gremium bestand aus fünf oder sechs Mann - wurde mir Zersetzung der Wehrkraft und Vorbereitung zum Hochverrat zum Vorwurf gemacht. Ich mußte nur unterschreiben, dass ich keine Ansprüche stellen würde. Man hatte dem Abt zugesagt, dass nichts in meinen Papieren erscheinen würde. Beim Militär fand ich doch —Rosa Papierež vor, was —politisch unzuverlässigž hieß, in denen das alles aufgeführt war. Solche Papiere wurden auch homosexuellen Männern ausgestellt. Wenn später beim Militär irgendetwas schief lief, habe ich immer gesessen als —politisch unzuverlässigž. Ich suchte gleich den Bischof auf. Doch der sagte: —Junge, das weiß ich doch schon alles. Zur Mutter brauchst du nicht mehr, die ist informiert. Geh' zu deinem Abt zurück, wir wollen nicht weiter darüber reden.ž VERSTECKT VOR DEN NAZIS Ich hatte einen ziemlichen Nervenzusammenbruch und wurde vom Abt zum Fürsten von Thurn und Taxis geschickt, der einige Leute versteckte, wo ich mit anderen gefährdeten Personen ein Vierteljahr verbrachte. Auch Pfarrer Dambach von der Mechternkirche in Köln zählte zu diesen Leuten. Auch für ihn bestand Gefahr, noch einmal verhaftet und —zum Schutz des deutschen Volkesž nach Dachau geschickt zu werden. Der Fürst lud uns einige Male zu sich nach Schwangau ein, wo ich Orgel spielen durfte. Auch viel später war ich öfter noch sein Gast. Um mich zu erholen, stieg ich viel in die Berge. Pfarrer Dambach sagte mir, wenn ich später einmal nach Köln käme, solle ich ihn in der Mechternkirche besuchen, die Peter Hecker ausgemalt hat. Der Pfarrer schenkte mir ein Buch über diese Kirche mit einer liebevollen Widmung. Auf der ersten Seite stehen Notizen über den Wettbewerb, der zur Ausmalung der Kirche ausgeschrieben wurde. Aufgrund dieses Wettbewerbs hat Emil Nolde religiöse Bilder gemalt. Hecker bekam den Auftrag, weil Nolde kein —fleißigerž Kirchenbesucher war. In seinem Haus in Seebühl sind die religiösen Bilder noch zu sehen. Nach dem Aufenthalt im Versteck konnte ich wieder im Kloster auftauchen. ZURÜCK IM KLOSTER Wegen der immer wieder auftretenden Stirnhöhlenvereiterungen war ich 1939 nur kurz zu einer Luftnachrichteneinheit eingezogen worden. Ich war seit dem 4. Mai 1939 Professe, d.h. ich hatte mich an die Klostergemeinschaft durch zeitlich befristete Gelübde gebunden. Als ich am 1. Dezember 1941 zur Marine kam, fühlte ich mich auch während des Krieges ganz als Mönch. Nach dem kirchlichen Recht dürfen in unsicheren Zeiten keine ewigen Gelübde abgelegt werden. Deshalb wurde die zeitliche Profess immer wieder verlängert. MILITÄRZEIT (1941-1945) Vom 1.Dezember 1941 an absolvierte ich eine dreimonatige militärische Grundausbildung bei einer Marineeinheit in Leer (Ostfriesland). Dort lernte ich meinen späteren Freund, den evangelischen Pfarrer Heiner Speckmann und den Glockengießer Schilling kennen. Mein Unteroffizier war Pater Bomm, der spätere Abt von Maria Laach. 1942 wurde ich zur Schulung in die Bereiche Verwaltungslaufbahn, Besoldung, Schriftverkehr, Ernährungswissenschaft und Schiffserkennungsdienst auf ein Schiff in Wilhelmshaven kommandiert. Den langen Märschen und Übungen in der Grundausbildung war ich wegen meines Herzfehlers und meiner chronischen Stirnhöhlenbeschwerden nicht gewachsen. Auf dem Schiff wurde ich dann in der Truppenbetreuung eingesetzt, wo es zu meiner Aufgabe gehörte, Literatur und Lehrmaterial zu beschaffen und für die —Unterhaltungž zu sorgen. Auch der Maler Blunk aus Kiel, Fotograf und Graphiker, und Maler Hofmann aus Regensburg waren zur Truppenbetreuung eingeteilt. Wir malten zusammen Kasernen aus mit Schiffen, Wikingern, Römern und trinkenden Bauern. Am Eingang einer Kaserne, einer früheren Arbeitsdienstunterkunft, über der geschrieben stand: —Arbeit macht freiž, modellierte ich in der Art von Arno Breker Wachsoldaten aus Ton und Mergel (Marmorsplitter). Wir illustrierten die Marinezeitung und organisierten Theaterstücke und Feiern. Dabei schafften wir es auch, Marlene Dietrich zu einem Gesangsauftritt einzuladen. Jeden Sonntag feierten wir in St. Marien einen Choralgottesdienst, denn es waren sechs oder sieben Benediktiner in der Gruppe. Auch betreute ich eine Gruppe in St. Wilhard bei Pfarrer Zumberge, für dessen Pfarrprozession ich in den Abendstunden Bilder zur Ausschmückung der Altäre malte. Vor Weihnachten saß ich bei Brot und Wasser vierzehn Tage —im Knastž mit Zeichenbrett, Anatomiebuch und Bibel. Ich war vom Militärgericht verurteilt worden wegen Zersetzung der Wehrkraft. Ich musste mich auf das Schlimmste gefaßt machen. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte die Mannschaft, wie ich meinte mit Erlaubnis, zur Messe geführt anstatt zur Schiffsreinigung, die angesetzt und von mir auch anschließend vorgesehen war. Außerdem hätte ich behauptet, an erster Stelle stände der Papst und nicht der Führer und ich würde ernstlich verbreiten, Maria hätte ein Kind ohne Zutun eines Mannes zur Welt gebracht. Außerdem belasteten mich meine sogenannten —Rosa Papierež, die ich nach dem Gefängnisaufenthalt in Würzburg erhalten hatte. In der Verhandlung kam ich nur deshalb ungeschoren davon, weil Marinedekan Dr. Breuer und ein Militärarzt dem Gericht vorbrachten: —Künstler spinnen allež, was mich wahnsinnig ärgerte. Danach schickte mich der Standortkommandeur, Corvettenkapitän Leu, der mir gewogen gewesen war und dafür gesorgt hatte, dass die Vorladung zum Kriegsgericht umgewandelt worden war in eine Arreststrafe, mit einem Augenzwinkern nach Münsterschwarzach, um —Material für die Truppenbetreuungž zu besorgen. Im Zug saßen Soldaten, die sich brüsteten, in einer Kirche Frauen vergewaltigt zu haben. Nach dem Krieg betrat Leu meine Werkstatt und bat mich um den —Persilscheinž, d.h. eine Bescheinigung, dass er kein Nazi gewesen war. Ein guter Briefkontakt blieb lange bestehen. Es folgte die Verlegung in die Nähe von Bremen, nach Zeven, wo ich die Truppenbetreuung für das ganze Lager zu bewältigen hatte. Dafür stand mir sogar ein eigenes Zimmer zur Verfügung. Ich musste eine Lagerzeitung herausgeben und Theater und Musikabende organisieren. Pfarrer Bodenburg lernte ich hier kennen, der in Zeven die Messe hielt. DAS MEISTERSTÜCK : ARMBAND MIT AMETHYSTEN 1943 Meine Meisterprüfung zum Gold- und Silberschmied konnte ich als Soldat während des Krieges in Bremen ablegen, wo der Unterricht in einem Bunker erteilt wurde. Eine Aktentasche mit Werkzeug gehörte immer zu meinem Gepäck. In meine Tasche passte fein säuberlich das nötige Material und Werkzeug, auch Dinge zum Löten und Schmelzen (Silberschmelzen) und ein Beutel mit Edelsteinen. Ein Fahrrad tat mir gute Dienste, um mich in meiner Freizeit auch bei einem Goldschmied auf meine Meisterprüfung vorbereiten zu können. Mein Meisterstück, ein gegliedertes Emaillearmband mit Amethysten, habe ich in der von mir ausgeknobelten Technik ausgeführt, was die Meister überraschte, weil keiner sich diese Technik vorstellen konnte. Offiziell durfte ich erst mit vierundzwanzig Jahren, also ab dem 13. September 1944, den Meistertitel tragen.  BEGEGNUNG MIT DEM MALER EWALD JORZIG In Zeven lernte ich den Maler Ewald Jorzig, einen Juden, kennen. Er hatte als Clochard in Paris gelebt, sich an den Reichsjugendführer Baldur von Schirach gewandt, der ihn nach Holland holte, von wo er auf Umwegen schließlich nach Zeven gelangte. Durch ihn lernte ich neue Aspekte der Kunst kennen, lernte eine andere Maltechnik und vieles mehr. Ich hatte immer fein säuberlich gemalt, er aber nahm meinen Malkasten, legte ihn auf die Straße und fuhr mit einem Borstenpinsel in den Farben herum. Tolle Bilder hat er auf der Straße entworfen. Bei den Fallschirmjägern in Neumünster war ich als Funker eingesetzt und kam anschließend zu einer Luftnachrichteneinheit nach Heidenau. Als wir mit der Luftnachrichteneinheit in der Nähe von Heidenau lagen, malte ich die schöne Kirche eines ehemaligen Benediktinerinnenklosters. Das Kloster war 1850 geschlossen worden, als die letzten Nonnen starben. Sie hatten unter evangelischer Leitung katholisch bleiben dürfen. Jorzig und ich malten beide ein Mädchen. Eine Reihe der Bilder sind in dessen Besitz. Wir hatten sie eingetauscht gegen Essen. Der Vater des Mädchens war Kunstschmied. So hatte ich Gelegenheit, Schmuck und Leuchter für Offiziere zu fertigen. Im weiteren Verlauf des Krieges, nach einigen Einsätzen auf See, wurde ich in Italien und Afrika eingesetzt. Auf der Rückfahrt von Tobruk, einem Naturhafen in der Bucht der Marmarika, traf den Öltanker, auf den ich zum Dienst mit zwei anderen eingeteilt worden war und der etwa zwanzig leicht Verwundete an Bord hatte, ein Geschoß, fünf Kilometer vor der Einfahrt in den Hafen von La Spezia. Das Torpedo, sichtbar an seinem Schaumstreifen, den es hinterließ, wahrscheinlich abgefeuert von einem englischen U-Boot, kam auf uns zu. Wir waren eingesetzt worden zum Geleitschutz eines Lazarettschiffs aus dem Rommel-Feldzug. Ein Todeskommando. Während der ganzen Fahrt hatte ich eine Schwimmweste getragen, denn ich konnte nicht schwimmen. Als ich ins Wasser gesprungen war, hielt ich unter dem einen Arm einen Stuhl, unter dem anderen einen Volksempfänger, denn ich stand unter Schock. Ich konnte mich von dem sinkenden Schiff retten. Ich tauchte immer wieder unter. Die Flammen waren nur oben heiß. Die Verwundeten mit den Schwimmwesten wurden zuerst aus der flammenden See gezogen auf das Lazarettschiff mit dem Roten Kreuz, das unbehelligt von den Engländern in den Hafen einfahren durfte. Später erfuhren wir, dass der englische General ein Bewunderer von Rommel gewesen war. ERFAHRUNGEN MIT DER PALA D'ORO IN VENEDIG Pala d'Oro, die goldene Altartafel in San Marco, wurde 976 von dem Dogen Pietro Orseolo in Byzanz in Auftrag gegeben, mehrmals restauriert und von venezianischen Künstlern erweitert. Sie besteht aus Emailleplatten und Emaillemedaillons - im Zellenschmelzverfahren hergestellt. Sie ist mit Edelsteinen und Perlen besetzt. Dargestellt sind unter anderem der thronende Christus, Maria, Apostel und Engel, Szenen aus dem Leben Jesu und aus der Markuslegende, sowie der byzantinische Festtagszyklus. Als Pala d'Oro wird auch das Aachener Antependium im Aachener Münster (um 1020) bezeichnet. Antependium bedeutet Vorhang, eine Verkleidung des Altarunterbaus aus kostbarem Stoff oder einer Vorsatztafel aus Edelmetall oder geschnitztem Holz. Man suchte beim Militär deutsche Goldschmiede aus Angst vor unzuverlässigen italienischen Landsleuten, um die Restaurierung der Pala d'Oro in Venedig zu beaufsichtigen und durchzuführen. So kam ich zum Goldschmieden und Emaillieren in den Markusdom. Pala d'Oro: der goldene Altar im Dom. Es gibt mehrere dieser Altäre in Italien. Auch für den Hochaltar in Aachen ist reines Gold verwendet worden. Bei dieser Arbeit in San Marco lernte ich viel über die alte Emailletechnik. Das, was ich hier vorfand, ist byzantinisches Emaille. In einem Buch hatte ich gelesen: Man hat eine goldene Platte genommen und die Konturen in die Platte einziseliert, so dass eine Vertiefung entstand, in die man Drähte einlegte und anschließend einbrannte. Das stimmt aber nicht. Das ist so nicht durchzuführen. Es würde reißen und viel zu viel Arbeit machen. Ich dachte mir, die Alten haben sich nicht gequält, sie müssen nach einer anderen Technik verfahren haben. Ich sah in Venedig die Goldplatten mit Emaille und dachte, du nimmst am besten eine auseinander. Und so erkannte ich, dass es sich um zwei Platten handelte, eine war ausgesägt, eine andere darunter gelegt. Ich hatte gelesen, daß auf chemischem Wege mit Kupfersalzen eine Verbindung hergestellt werden konnte. Zinklot gab es erst später seit dem 18. Jahrhundert aus China. Das bei der Pala d'Oro verwendete Gold mußte aber hochkarätig sein, damit es einen hohen Schmelzpunkt aushielt. Hier mußte Kupfersalz hineingestreut worden sein, denn da, wo Kupfer und Gold zusammenkommen, senkt sich der Schmelzpunkt um 200 Grad und die Metalle verschmelzen. Der Untergrund musste noch kupferhaltig gewesen sein. Die darauf gelegten Feingolddrähte waren wieder erhitzt worden und so ohne Lot geschmolzen. So einfach war die alte Technik. Als ich nach dem Krieg wieder im Kloster war, wollte ich mit dieser wiederentdeckten Technik experimentieren. Ich hatte nur Silber zur Verfügung, kein Gold. Als Meister Adelmar zu Weihnachten als Küster fern der Werkstatt eingesetzt wurde, begab ich mich heimlich an die Arbeit. Ich hatte die Technik mit dem Silber zum ersten Mal ausprobiert, denn ich kenne nicht eine einzige Granulation in Silber, die in Büchern beschrieben ist. Granulation ist in der Goldschmiedekunst eine dem Filigran verwandte uralte Technik, bei der Schmucksachen durch aufgelötete Gold- und Silberkügelchen verziert werden. VOM SKORPION GEBISSEN Während eines Einsatzes in La Spezia 1943 an der Westküste Italiens auf der Insel Marmozza wurde mir aufgetragen, schwere Geschütze auf die italienische Gradzahl Milesimi umzurechnen und einzustellen. Eines Nachts fing ich einen Skorpion in einer Dose und verstaute sie in meiner Hängematte. Das Tier entschlüpfte und biß zu. Alle standen vor einem Rätsel. Keinem konnte ich meine plötzliche Erkrankung erklären, da ich dazu unfähig geworden war. Ein Vierteljahr verbrachte ich in einer —Klapsmühlež, weil ich einem —Rechenwahnž verfallen war. Danach stellte sich eine schwere Gelbsucht ein, die in einem Lazarett in Arco am Gardasee auskuriert werden musste. Das war zu der Zeit als Mussolini, der Duce, gerade von den deutschen Fallschirmjägern in einem Putsch im September 1943 aus der Haft auf dem Campo del Imperatore befreit worden war. Nach meiner Genesung wurde ich 1944 bei den Fallschirmjägern in Neumünster in Holstein als Funker eingesetzt, danach in einem Ersatzbatallion in Heidenau wieder bei der Luftnachricht. TODESURTEILE Anfang des Jahres 1945, ungefähr vier Monate vor Kriegsende in Heidenau, sollte ein Theologiestudent aus Elsaß-Lothringen zu der SS. Er war abgehauen und hatte sich auf einem Bauernhof in der weiteren Umgebung versteckt. Eine Tochter der Bäuerin sorgte heimlich für ihn und beide —brannten durchž. Da sie nichts zu essen fanden, klauten sie Lebensmittel und wurden eines Tages entdeckt. Auf Diebstahl von Lebensmitteln und Feldpostpäckchen stand im Krieg die Todesstrafe. Er sollte standrechtlich, das ist die Erschießung nach einem Schnellverfahren, erschossen werden. Es wurde ausgerufen, wer sich freiwillig für das Erschießungskommando melden würde. Niemand. Da hieß es, den —Eiersackž, den Klosterbruder holen wir uns. Ich wurde hinkommandiert, ihn zu erschießen. Zuerst sollte ich ihm die Schnur um den Hals binden und die Schlinge durch das Loch im Pfahl ziehen. Mein Zittern machte das unmöglich. Der Offizier, der die Erschießung leitete, übernahm das Festschnüren. Ich aber mußte ihm die letzte Zigarette anzünden. Das war so schlimm. Er hat ja nichts mehr gesehen mit der Binde über den Augen. Der Arzt gab ihm eine Spritze ins Herz. Dann wurde geschossen. Seitdem überfällt mich schon ein Zittern, wenn ein anderer eine Zigarette raucht. Einen von zwei anderen, die erschossen werden sollten, kannte ich. Wir waren eine Zeit lang zusammen zur Kirche gegangen. Er war Student und kam gerne mit. Auf dem Weg zum Gottesdienst entdeckten wir eines Tages Leichen im Wald, darunter einen katholischen Offizier, der dort hinkommandiert worden war und die Kompanie hatte übernehmen sollen. Er war Vater von vier Kindern und hat sich bestimmt nicht selbst erschossen, wie es später offiziell hieß. An ihn mußte ich öfter denken. Im Krieg, wenn wir jemanden erschießen sollten, hieß es, wir dürften das, weil wir sonst unser eigenes Leben gefährden würden. Arnold, ein Dominikanerbruder, war dem Großdeutschlandregiment in Berlin zugeteilt und hatte jeden Tag Hinrichtungen durchzuführen. Der Mann verzweifelte, meldete sich freiwillig zur Front und landete später im Militärgefängnis. Im Krieg haben wir immer wieder über dieses Thema diskutiert. Dürfen wir töten? Wer hat die Macht über das Leben eines anderen? WIR KÖNNEN NICHT GENUG HASSEN - NEIN: LIEBEN! Am Ende des Krieges, 1945, rückten die Russen von Osten aus heran. Zu dem Zeitpunkt war ich bei Küstrin, das an der Mündung der Warthe in die Oder liegt, eingeteilt zur Truppenbetreuung. Im —Völkischen Beobachterž hatte Goebbels einen Artikel verfasst über das Thema —Wir können nicht genug hassenž. Darüber sollte ich einen Vortrag halten. Ich habe das ganze umgedreht in —Wir können nicht genug liebenž. Ich habe von der Liebe des hl. Augustinus gesprochen. Ein Politoffizier, ein SS-Mann, der mir zuhörte, sprang auf, zielte auf mich mit der Pistole. Aber seine Freundin und die Sekretärin von Dr. Dr. Dunker retteten mein Leben. Sie warfen sich dazwischen und eine riß seinen Arm runter. Sie redeten auf ihn ein. Noch am Abend haben mich der Politoffizier und Dr. Dr. Dunker festgenommen. Ich sollte nun doch noch zum Tode verurteilt werden. Tags darauf sollte mich der Politoffizier zum Kriegsgericht nach Flensburg überführen, wohin das Gericht von Berlin aus verlagert worden war. Er hatte Order, noch einen Umweg über das Führerhauptquartier in Berlin zu machen, um für die Truppe Ersatzteile von Funkgeräten und Radios in den Ascaniawerken zu besorgen. Die Funkgeräte und Radios dienten dem —Einsatz zur moralischen Wiederaufrüstungž. Zurücklassen mußte ich meine Aktenmappe und mein Fahrrad. Bevor wir mit dem Motorrad nach Berlin fuhren, hatten wir, der Politoffizier und ich, gesehen, dass Dr. Dr. Dunker, der viele Hinrichtungen durchgeführt hatte, rücklings aus dem Fenster fiel. Er hatte sich mit Zyankali vergiftet. Somit hatte der Politoffizier mehr oder weniger Freiheit und wußte auch nicht recht, was er mit mir machen sollte.  IM FÜHRERHAUPTQUARTIER Unten im Bunker in der Wilhelmstraße sahen wir, der Politoffizier und ich, Arthur Axmann und Joseph Goebbels, der sich und seiner Familie zwei Tage danach mit Gift das Leben nahm. Adolf Hitler war in einem Nebenraum. Mein NS-Führungsoffizier sagte: —Da sitzt Goebbels mit seiner ganzen Familie, da können wir jetzt nicht rein.ž E.G.W. und B(runo) sitzen während der Erzählung in Denia zusammen. B. unterbricht, um einige wichtige Details zu erfragen. Bruno: —Arthur Axmann, das war doch der Hitlerjugendführer, der Nachfolger von Schirach.ž Eva: —Ja, er hat bestimmt tausend Hitlerjungen in Berlin eingesetzt zum Endkampf.ž E.G.W: —Wir fuhren also zu Ascania nach Steglitz. Mir hatte ein Offizier an diesem Tag gesagt, es ständen Flugzeuge zur Flucht bereit, die Hitler und seine Eva Braun, die er kurz vor seinem Tode geheiratet hatte, nach Garmisch und weiter nach Brasilien bringen sollten. Alles sei vorbereitet. Der Politoffizier dachte inzwischen auch an Flucht. Er stammte von einem Rittergut hinter Potsdam. Da wollte er hin. Er wusste von den zur Flucht bereitgestellten Flugzeugen auf dem Tempelhofer Feld.ž B.: —Noch einmal: Du hattest zu einem Artikel ,Wir müssen mehr hassen' Stellung genommen und über Augustinus gesprochen. Was waren das für Leute, vor denen du sprachst und in welcher Eigenschaft, als was sprachst du, warst du nur Diskussionsredner oder hattest du den Auftrag, einen Vortrag zu halten?ž E.G.W.: —Ich war beim Nationalsozialistischen Führungsstab in der Truppenbetreuung.ž B.: —NSFO?ž E.G.W.: —Ein Nationalsozialistischer Führungsoffizier war mein Chef. Der hatte mir den Artikel aus dem Völkischen Beobachter gegeben, ich sollte ihn mir durchlesen. Ich habe gesagt, ihr könnt nicht genug lieben. Um vier Uhr nachmittags hatte ich den Auftrag bekommen und sollte abends den Vortrag halten.ž B.: —Wieviel Leute waren das? Alle von der Marine?ž E.G.W.: —Nein. Ehemalige, wir wurden alle zusammengewürfelt.ž B.: —Wieso kam der auf dich? Warst du als guter Redner bekannt?ž E.G.W.: —Nein, als frommer Mensch. ,Der Klosterbruder' wurde ich genannt. Der wollte mich zu einem Nationalsozialisten machen.ž B.: —War er ein Überzeugungstäter?ž E.G.W.: —Ich kannte ihn zu wenig. Er war kurz zuvor zu uns gestoßen mit seiner Sekretärin. Ich hatte mir den Aufsatz durchgelesen und gedacht, was für ein Quatsch. Und dann habe ich mir gedacht, so geht das nicht, wir können nicht genug lieben. Wenn wir genug lieben, dann würden wir Frieden schaffen. Es ging ja um den Frieden. Man war ja noch Soldat, um die bolschewistische Plage von unseren Leuten wegzuhalten.ž B.: —Die Russen, die wie ein Unheil über uns herfielen. Später las ich ein Buch von Gerlich, darin stand: —Der Kommunismus und Sozialismus waren die Plagen, die über Europa herfielen.ž Der Gerlich hat das mit dem Nationalsozialismus verbunden. Beide waren gleich schlecht.ž E.G.W.: —Er war einer der ersten, der durchsiebt wurde, weil er Schriften gegen Hitler schon 1928 herausgegeben hatte. Ich habe ihn nicht kennengelernt, nur seine Schriften verteilt an der Kirche als Achtjähriger. Der Pfarrer hat uns immer unterrichtet, ein großartiger Mann. Sein Bruder war Landrat in Köln gleichzeitig mit Adenauer als Bürgermeister. Gerlich wurde am gleichen Tag wie Klausener am 30. Juni 1934 ermordet.ž E.: —Er war übrigens einer, der mit dem 'Spuk' um die Therese von Konnersreuth aufräumen wollte, dabei aber zum Glauben fand.ž E.G.W.: —Wir waren also im Führerhauptquartier. Ich sollte von da hoch in den Norden zum ordentlichen Kriegsgericht nach Flensburg zur Verhandlung gebracht werden. Die gesamte Militärverwaltung wurde in dieser Zeit von Berlin nach Flensburg verlegt. Admiral Dönitz war als Nachfolger von Hitler benannt. Durch das Eingreifen der beiden Sekretärinnen war meine sofortige, also standrechtliche Erschießung, verhindert worden.ž IM GEFANGENENTRANSPORT KURZ VOR KRIEGSENDE Egino berichet weiter: Der Offizier lieferte mich befehlsgemäß zunächst in Oranienburg ab. Das liegt nordwestlich von Berlin. Das Konzentrationslager Oranienburg wurde gerade aufgelöst und all die Gefangenen sollten nach Hamburg transportiert werden. Wir waren zu Fuß von Oranienburg in Richtung Norden unterwegs. Die anderen KZ-ler aus Sachsenhausen und Militärgefangene trugen —gestreifte Anzügež. Ein zusammengewürfeltes Volk, viele Soldaten waren von ihrer Einheit abgehauen und unterwegs wieder aufgegriffen worden. Tiefflieger schossen auf alles, was sich bewegte. Im Schloß Ludwigslust bei Heidenau angelangt, wurden wir eingeteilt. Ich kam in das Lazarett, das heißt, in das beschlagnahmte Schloß. Die meisten mußten auf der Wiese kampieren. Aus dem Keller des Schlosses sollten wir uns Lebensmittel holen. Ich war uninteressiert, ich hatte keinen Hunger. Ein Sanitäter, ein Pater aus Ettal, rief mich zu Hilfe bei einer Entbindung. Ich habe von allem nicht viel gesehen, ich mußte Wasser heiß machen. Wir mußten in der Nacht wieder aufbrechen und die Frau mit ihren drei Kindern zurücklassen. Einer hatte noch aus dem Keller Lebensmittel besorgt und sie zu ihr hingelegt. Sie war die Frau eines Polizeioffiziers aus Berlin, auf der Flucht wurde sie von der Geburt überrascht. Der Pater aus Ettal hüllte mich in eine Militärjacke, es war ja kalt, und er wollte mir noch eine Pistole in die Hand drücken, aber ich lehnte ab. Dann sind wir weitergelaufen unter dem Kugelhagel von Tieffliegern. Alle liefen und stolperten über tote Pferde. Die Gefangenen fielen darüber her, schnitten sie auseinander, rösteten und aßen gierig das Fleisch. In einem Wald stieß ich auf meine Division, die Richtung Süden aufgebrochen war. Sie verteilten gerade Lebensmittel. In dem Moment aber tauchte Frau Kreuzer auf, eine der beiden Frauen, die dazwischengesprungen waren als man mich erschießen wollte. Sie hatte meine Edelsteine und mein Fahrrad aufgehoben. —Hier hast du die Edelsteine, wir werden zu den Amerikanern rübergehen und gegen die Russen kämpfen.ž Ich meinte, wir sollten das Fahrrad vergraben. Ich habe eine Wurst eingesteckt und die Taschen voll Traubenzucker. Am anderen Tag wurden wir auf einem Laster abtransportiert. Der Trupp zog weiter. Ich wurde zu einem Kommando eingeteilt, das aus einem Lager noch die ganzen Truppenpapiere herausholen und auf einen LKW verfrachten sollte. Als wir auf dem Hof des Lagers waren, wußten wir nicht, dass die Russen schon hinter uns im Graben lagen. Während wir riesige Kisten aufluden, standen Häftlinge aus dem KZ Oranienburg spöttelnd auf dem Wagen und ich, ein junger Kerl, sollte die Kisten von unten auf den Wagen heben. Da hörte ich einen Knall, der Wagen ging hoch, ich lag unter der Kiste. Als ich um mich griff hielt ich den Kopf in der Hand, von dem Kameraden, der mich gerade noch angemeckert hatte, ich sollte richtig hochheben. Der Wagen hatte einen Volltreffer, das Haus ein Loch. Ich wusste, wenn die Granaten so schnell kommen, daß man sie nicht mehr hören kann, ist der Feind ganz nah. Also lief ich so schnell ich konnte über Wiesen. Auf einmal galoppierten vom Waldesrand lauter Kühe auf mich zu. Tagelang waren sie nicht gemolken worden. Ich lief und lief, erst vor den Russen, jetzt vor den Kühen über die Koppeln. So schnell bin ich noch nie gelaufen. Ich kam an eine Brücke, die über einen mecklenburgischen Kanal führte. Da rief einer: —Mensch, mach schnell, schnell, wir sprengen!ž Alle lagen schon in Deckung. Drüben stieß ich wieder auf den Pater aus Ettal. Er bestürmte mich: —So, jetzt nimmst du aber einen Revolver, haust ab und wirst wieder Soldat.ž Ich sagte: —Komm, mir ist das alles so schnuppe.ž Er lud mich auf ein Lastauto, das bis zu einem Wald fuhr. Wir stießen in den Bereich der Amerikaner. Ich wollte zu einem amerikanischen Geistlichen vorpirschen, doch da schrien alle, die Amerikaner würden schon auf mich zielen, denn ich hatte das Sperrgebiet bereits überschritten. Mit erhobenen Händen ging ich wieder zurück zu den amerikanischen Soldaten, zeigte mein Foto aus dem Kloster, woraufhin ich zu dem Geistlichen vorgelassen wurde. Er setzte mich kurzerhand auf den Kühler des Jeeps und hob an zu einer wilden, holprigen Fahrt. Wir erreichten die englische Zonengrenze. An einer Schleuse bei Lauenburg, südöstlich von Hamburg, setzte er mich ab. Der Hühnerstall, in dem ich übernachtete, füllte sich in der Nacht mit geflüchteten Soldaten. Am frühen Morgen wollten wir über die Elbe schwimmen, doch da warnte der Bauer, es seien schon so viele erschossen worden, die über den Fluß wollten. Flußabwärts aber sei eine Pontonbrücke von den Engländern erbaut. Er gab mir Zivilkleider seines Sohnes, der gefallen war. Ich gelangte zur Brücke, wo es hieß, alle deutschen Gefangenen kämen nach Rußland. Ich ging zur Seite. Einer fragte: —Hast du keine Papiere?ž —Neinž, sagte ich, —Nichts, nur mein Bildchenž. Es zeigte mich inmitten der Klosterbrüder. Der amerikanische Geistliche hatte darauf in Englisch geschrieben: —Laßt ihn laufen, er ist ein KZ-Häftlingž. Über die Brücke durften gruppenweise Niederländer, anschließend die Italiener. Ich gab mich einfach als Italiener aus. Mit ein paar Brocken italienisch sagte ich, ich wäre Mönch von Monte Cassino und zeigte mein Bild aus dem Kloster. Ich durfte die Brücke passieren in das von den Amerikanern besetzte Gebiet im Westen. KRIEGSENDE - GERETTET Noch nie habe ich so gejubelt. Ich ging mit tanzendem Schritt, hörte noch einen hinter mir herschreien, aber ich drehte mich nicht um. Drüben wäre ich am liebsten auf die Knie gefallen. Befreite Holländer hatten Militärfahrzeuge besorgt, mit denen sie im Konvoi weiter nach Lüneburg fuhren. Ich wollte mich da im Gefangenenlager melden, denn ich war und fühlte mich ja noch als ein —Zum-Tode-Verurteilterž. Die Leute hinter dem Zaun riefen: —Du bist wohl verrückt, hier kommst du nie mehr raus, wir alle kommen nach Rußland!ž Erschöpft schleppte ich mich zu der nächstliegenden Kirche in Lüneburg und klopfte bei dem Pfarrer an. Ich bat um Aufnahme. Der aber schickte mich weg. Gegenüber dem Pfarrhaus beobachtete eine Frau das Geschehen. Sie öffnete ihre Türe und nahm mich auf. Ich hatte meine Sprache verloren, brach zusammen und wachte nach drei Tagen dort im Bett auf, umgeben von einem Haufen Kinder. Ihre Mutter hatte mich gepflegt. Eine befreundete Jüdin, die —meine Papierež eingesehen hatte, brachte Lebensmittel. Sie päppelten mich hoch, brachten mir Kaffee, den ich kannenweise trank. Später nahmen sie mich mit zur Kirche. Der Pfarrer las das Evangelium und hielt eine Predigt über das Thema —Ohne Liebe wäre alles nichtsž. Nach der Messe ging ich zu ihm in die Sakristei: —Können Sie sich noch erinnern, vor drei Tagen stand ich bei Ihnen vor der Tür und hätte nur auf dem Fußboden schlafen wollen, mehr nicht.ž —Ich weiß ja nicht, wer da kommtž, antwortete der Pfarrer, —es gibt so viele Verbrecher.ž Monate später meldete er sich im Kloster Münsterschwarzach und erkundigte sich, was aus mir geworden sei. Die Jüdin nahm mich mit in ein Kaufhaus, das beschlagnahmt worden war. Da hingen doch wahrhaftig die besten Anzüge. Sie kleidete mich ein. Den Pfarrer fragte ich nach einem Fahrrad. Er verwies mich weiter an einen reichen Mann in der Gemeinde, einen Brauereibesitzer. Den suchte ich auf, denn ich wollte zurück zum Kloster. Er fragte, ob ich etwas zum Tauschen hätte, woraufhin ich ihm einen alten Diamantring anbot. Er verschwand und kam nach einer Weile wieder - mit meinem eigenen Fahrrad. Mit dem Fahrrad radelte ich zuerst zu Pfarrer Bodenburg, der Militärpfarrer in Heidenau gewesen war. Er wollte seinen Bischof in Hildesheim aufsuchen, und bat mich, ihm zu helfen, in seiner Abwesenheit Beerdigungen durchzuführen. So hielt ich drei Beerdigungen. Ein Pole hatte Lebensmittel geklaut und wurde erschossen. Ein anderer hatte Fernmeldeleitungen abgerissen, auf denen noch Spannung lag. Der dritte war ein Russe. Seine Freundin wollte in das Loch hinterherspringen. Als der Pfarrer zurückgekehrt war, machte ich mich weiter mit dem Fahrrad auf den Weg zurück ins Kloster Münsterschwarzach, die Taschen vollgestopft mit Traubenzucker. Er hatte mir noch BDM-Mädchen und Marinehelferinnen mitgegeben, die ich begleiten und beschützen sollte. Eine davon lieferte ich auf dem Weg nach Göttingen ab, eine andere brachte ich in einen Nachbarort von Gevelsberg und zwei schrieben mir noch später aus Trier. So kam ich am 28. Mai 1945, zwanzig Tage nach Kriegsende, als Erster in Münsterschwarzach aus dem Krieg zurück. Total verwanzt, verlaust und kaputt. Ein paar alte Brüder, die das beschlagnahmte Kloster und die Landwirtschaft versorgt hatten, waren noch da. Vater Abt war erst kurz zuvor wieder eingetroffen.  VERLUST DER RECHTEN HAND 21. März 1946 Nach Kriegsende sickerten nur selten Nachrichten ins Kloster durch. Den Vater Abt bat ich, mich nach Berlin zu schicken, um nach meinen Eltern sehen zu können. In Berlin war alles zerstört. Viele waren verzweifelt, so manche begingen Selbstmord. Die Eltern waren erschüttert, als ich ankam. Der Vater hatte sich noch tags zuvor mit Selbstmordgedanken getragen, als ein Care-Paket aus Amerika von den Eltern eines Mönchs aus Münsterschwarzach eintraf. Meine Eltern wurden mehrmals ausgebombt. Hinter dem Grundstück meiner Eltern mit dem Gartenhaus in Berlin-Blankenfelde, in das sie geflüchtet waren, befand sich ein russisches Lazarett, eine Art —Rotes Kreuzž. Die Russen hatten das Stromkabel von unserem Haus, das sie kurze Zeit bewohnt hatten, abgelöst und in das Lager geleitet. Von den Russen erbat sich meine Mutter eine Sicherung, die bei uns defekt war. Meine Mutter, die durch einen Sturz - ein Russe hatte sie von dem Dachboden der Scheune gestoßen - stark verletzt war, drängte mich, unsere Sicherung gegen die neue auszutauschen. Ich war schon zu müde und bat sie, bis zum nächsten Morgen nach der Messe zu warten. Als ich am nächsten Tag aus der Messe kam, hielt sie mir schon die Sicherung entgegen. Ich wunderte mich, daß das Ding so schwer und mit einem Knopf versehen war. Ich wollte die Sicherung einsetzen, drückte auf den Knopf, es gab einen Knall, und meine rechte Hand war weg. Nur mein Daumen war noch da. Ich rannte, ohne ein Wort zu verlieren, zum Arzt, der neben dem Pfarrer wohnte. Er war so geschockt und verdattert, daß das Abbinden nicht klappte. Auf der Straße kam zum Glück ein Mann mit einem Dreirad vorbei, der mich auf seinem angehängten Wägelchen nach Lichtenfelde bringen wollte. Ein Amerikaner sah mich in der Lache Blut stehen, lud mich auf seinen Jeep und fuhr mich zum nächsten Lazarett. Kein Arzt stand in drei Krankenhäusern zur Verfügung. Am Tempelhoferfeld aber stand noch das Josefskrankenhaus am Flughafen. Der Arzt legte mich auf den Operationstisch und fragte, wer ich sei. Ich sagte: —Schneiden Sie ab, ich bin Maler.ž Das war das letzte, dann wurde ich ohnmächtig. Das war 1946 - eine schlimme Zeit. Wir lagen in großen Sälen in Betten oder auf der Erde. Nachts kamen noch Mädchen von draußen geflüchtet und versteckten sich bei uns, weil die Russen viele Mädchen vergewaltigten. Einen Tag später schon schrieb ich einen Brief ans Kloster mit der linken Hand. Ich war also das Opfer einer getarnten russischen Sprengkapsel geworden. Soweit die Erzählung von Egino. Kurz bevor Egino seine Hand verlor, hatte er eine wunderbare Kommunion erlebt. Er wollte sich dem Heiland voll und ganz hingeben. Als er dann eine halbe Stunde später seine Hand verloren hatte, war er noch so sehr beeindruckt, dass er dachte: —Lieber Gott, ist schon recht, jetzt muss ich Maler werden.ž Verwundet kehrte er nach Münsterschwarzach zurück. Nach ein paar Tagen drängte er den Abt, ihm die Erlaubnis zu geben, den Chirurgen Professor Sauerbruch in München aufsuchen zu dürfen. Sauerbruch sah sich seinen Arm an und meinte: —Das muß mindestens ein Jahr heilen, bevor etwas gemacht werden kann. Ich würde vorschlagen, Elfenbeinstäbchen in den Muskeln anzubringen, damit das Greifen mit einer Prothese möglich wird.ž Er bekam einen Behelf. Im Laufe der Jahre aber hat er sich kistenweise Prothesen gebaut. Zurück aus München hoffte Egino, dass der Abt ihn jetzt malen lassen würde. Der aber bestand auf der Weiterarbeit in der Goldschmiede. MEIN ERSTES WERK MIT EINER HAND - EINE PAXTAFEL (1946) Egino berichtet weiter: Nach 14 Tagen, in denen ich nichts geschaffen hatte, kam Vater Abt und sagte: —Machen Sie mal etwas, was Ihnen Freude macht. Sie können machen, was Sie wollen.ž Ich sagte ihm, ich würde gerne eine Paxtafel anfertigen. Eine Paxtafel wurde früher den Mönchen in der Messe zum Friedenskuß nacheinander gereicht. —Ja, machen Sie die schönste Paxtafel, die Sie machen könnenž, und er riet mir, keine Hilfe in Anspruch zu nehmen. —Aber lesen Sie erst einmal Literatur darüber.ž —Vater Abt, das habe ich schon.ž —Was, alles können Sie schon? Das ist ja unerträglich mit Ihnen.ž Ich bot ihm an, alle Bücher zu bringen, die ich über Paxtafeln gelesen hatte, ging in die Bibliothek und suchte einen Wäschekorb voller Bücher zusammen. Der Abt dachte, ich wollte ihn veräppeln, als er die vielen Bücher sah, lenkte dann aber ein: —Gehen Sie in die Werkstatt und beginnen Sie mit ihrem Werk.ž Keiner durfte mir helfen. Innerhalb von vier Wochen entwarf und fertigte ich sehr sorgfältig eine Paxtafel. Sie ist zwei Hand breit groß, in Metall getrieben, mit aufgelöteten Emaillebildern und einem geschwungenen rückwärtigen Griff versehen. Eva: —Was stellt diese Tafel, die du gemacht hast dar?ž E.G.W.: —Die zwölf Apostel. In der Mitte der Kristall, ein Rauchquarz, stellt Jesus dar. Mein Stumpf war ja noch ganz weich und schmerzte sehr. Ich versuchte, möglichst alles so umzubauen, daß ich es mit einer Hand bedienen konnte. Es gelang mir, daß ich die ganze Paxtafel mit allem, was ich dazu brauchte, alleine schaffte. Das ist, glaube ich, mein schönstes Stück geworden.ž Eva: —Wo ist sie denn jetzt?ž E.G.W.: —Sie liegt im Tresor in Münsterschwarzach in der Goldschmiede.ž Eva: —Sind denn Abbildungen davon gemacht worden?ž E.G.W.: —Ja. Endlich war ich frei gewesen, zu machen, was ich wollte. Alle Emailles habe ich in vier, fünf Tagen gemacht.ž Eva: —Mit diesem wunden Stumpf?ž E.G.W.: —Das war kein Problem, schlimmer war es, die große Schale zu hämmern. Im Kloster hatte ich ja die Technik der Granulation mit Silber entwickelt. Die Paxtafel hat damals zweihundertfünfzig Mark gekostet, heute würde sie bestimmt zweitausendfünfhundert Mark kosten.ž Eva: —Die wurde herumgereicht bei den Mönchen während der Messe?ž E.G.W.: —Zum Friedenskuß vor der Kommunion, wo ich das unverschämte Wort geprägt habe —Kußmaschinež. Eva: —Du bist jedenfalls glücklich, daß Du die Paxtafel geschaffen hast.ž E.G.W.: —Da hat der liebe Gott die Hand geführt. Ich glaube, jeder hat seine Aufgabe. Der, der das Leid zu tragen hat und der, der die Freude zu tragen hat. Das Leid annehmen, dem Schöpfer vertrauen. Ich glaube, ich hätte heute nicht mehr den Mut, mich dem lieben Gott so wie ein junger Mensch hinzugeben: Er wird alles schon richtig machen. IN DER GOLDSCHMIEDE In einem kleinen, unscheinbaren Gebäude in dem Komplex der Klosteranlage führt eine schmale Holztreppe zur Goldschmiede, wo öfter mal Besucher hinfanden. Der damalige Regens Julius Döpfner, der später von 1948 bis 1957 Bischof von Würzburg war, danach Kardinal in Berlin und München, kam immer zu uns ins Kloster zur Beichte. Seine Danksagung hielt er still in einem Raum neben der Goldschmiede, in dem ich die Edelsteine aufbewahrte. Er setzte sich danach manchmal zu mir an den Arbeitstisch und wir plauderten. Zu der Zeit wurde Regens Döpfner zum Bischof von Würzburg ernannt, und Architekt Schädel, sein Diözesanbaumeister, baute die St. Alfonskirche, die von den Würzburgern wegen ihrer Form —Sprungschanzež genannt wird. Die große Rückwand, innen über dem Altar in St. Alfons, malte und gestaltete Georg Meistermann. Mit ihm arbeitete ich später, 1957, in Solingen gleichzeitig an der Inneneinrichtung der St. Michaelskirche. Meistermann setzte sein großes Seitenfenster mit dem Motiv der Dreifaltigkeit im Altarraum ein. Mit fast allen weiteren Einrichtungen wurde ich vom Pallottinerorden 40 Jahre lang beauftragt. Später erfuhr ich, Döpfner habe so gerne mich, die —Berliner Schnauzež gehört. Ich erzählte ihm von meinen Bildern, von Nolde. Auch den späteren Prälaten Max Rössler lernte ich hier kennen, der mir bei einem seiner ersten Besuche im Kloster ein kleines Buch über den Künstler Vermeer schenkte mit dem Eintrag: —Kunst ist gestaltete Sehnsucht.ž DER —HEILIGE GEHORSAMž - MEIN WUNSCH, MALER UND BILDHAUER ZU WERDEN Eines Tages überraschte mich mein Kriegskamerad Ewald Jorzig im Kloster. Er überzeugte den Abt, mich auf die christlich orientierte Werkschule in Köln zu schicken. Der Abt verbot mir, weiterhin zu malen. Er meldete mich deshalb in der Goldschmiedeklasse der Werkschule an. Dort studierte ich von 1947-1949. B.: —Es ist risikoreich, sich unter den Befehl anderer zu stellen, weil man sein eigenes Leben leben muß.ž E.G.W:. —Ja, was mir sehr große Sorgen macht, ist der Heilige Gehorsam. Gehorsam ist, auf Gott hören, horchen, nicht seinen eigenen Willen ausführen, sondern den Willen Gottes. Aber wo ist der Wille Gottes?ž B.: —Den mußt du erstmal erkennen.ž E.G.W.: —Ich habe immer gesagt, wenn der liebe Gott mich als Maler und Bildhauer haben will, können sich der Abt und alle auf den Kopf stellen, dann werde ich Maler und Bildhauer. Und ich landete in der Landwirtschaft, ich landete in der Küche.ž B.: —Du warst dir immer bewußt...ž E.G.W.: —Im Hintergrund stand es wie ein Gebet, wie ein Glaube. Wenn ich die Möglichkeit hatte, habe ich immer gezeichnet, selbst auf dem stillen Ort. Aber eine innere Stimme drängte mich, du musst lernen. Ohne Lehre in der Malerei, in der Bildhauerei geht es nicht, das war mir klar. Ich ging immer zu den Patres und Brüdern, die Bildhauer waren. Bei denen lernte ich viel.ž Wenn einer eine Kunstschule besucht, erfährt er die Grundregeln der Kunst, der Formen, der Disziplinen, der Architektur. Eines Tages konnte ich selber auf die Kunstschule nach Köln gehen. Das war eine tolle Sache, aber auch eine Erfüllung, dass der liebe Gott mich hat dahin haben wollen. Ich war beflügelt, war mir sofort sicher, dass meine Bilder so ihre eigene Gestalt haben werden. 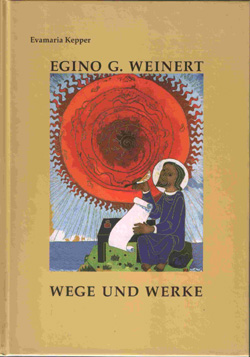 |
 |
|
| Bezug: Direkt durch Bestellung per Post (Brief/Postkarte) an: Dr. Evamaria Kepper Lacherstraße 44 D-42657 Solingen PREIS: 19,80 Euro |
|
| Für mehr Informationen zu EGINO WEINERT klicken Sie bitte HIER ! |
|
|
Impressum: Verantwortlich
für den Inhalt dieser Seiten: Tel. 0212-812617 |
|
|
- S E I T E N E N D E -
|
|